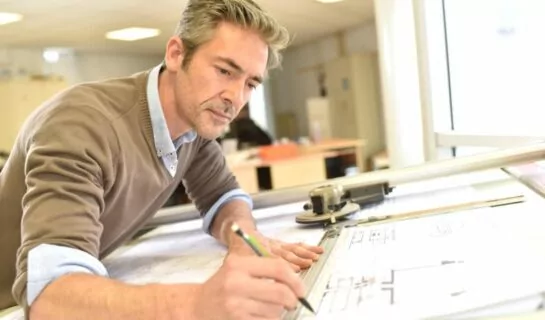OLG Koblenz – Az.: 2 U 394/13 – Beschluss vom 23.07.2014
1. Der Senat beabsichtigt nach vorläufiger Beratung, die Berufung gegen das Urteil der 9. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz vom 21.02.2013, Az. 9 O 167/12, gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen, weil er einstimmig der Auffassung ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, der Rechtssache auch keine grundsätzliche Bedeutung zukommt und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordert. Auch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über die Berufung ist nicht geboten.
2. Hierzu besteht Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 20.08.2014.
Gründe
D

ie Beklagte ist Eigentümerin eines Grundstücks in …[Z], auf welchem sie eine – zum Betrieb einer Wurstmanufaktur genutzte – Halle errichten ließ. Sie beauftragte – unter Einbeziehung der VOB/B – im November 2008 die Klägerin mit der Lieferung und Verlegung eines Industriefußbodens „Monile“. Nach Verlegung des Estrichs erbrachte die Klägerin die beauftragten Leistungen; die förmliche Abnahme erfolgte am 25.11.2008. Vom vereinbarten Preis von 48.801,90 € zahlte die Beklagte insgesamt 45.665,45 €.
Bereits nach wenigen Wochen zeigten sich Rissbildungen im Fußbodenbelag; derartige Risse wurden auch im Rahmen einer Baubegehung am 28.9.2009 festgestellt. Die Parteien streiten darüber, ob diese Risse auf die Lasteinwirkungen in der Wurstmanufaktur und eine nicht ausreichend belastbare (Estrich-)Unterkonstruktion zurückzuführen seien oder die Klägerin den Monile-Belag zu früh auf den Estrich aufgebracht habe, wodurch es zu Schwindrissen gekommen sei.
Im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens (9 OH 37/09) hat das Landgericht ein Sachverständigengutachten nebst Ergänzungsgutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beschichtungen und Kunststoffe im Bauwesen Prof. Dr.-Ing. …[A] eingeholt und den Sachverständigen am 3.5.2012 seine Gutachten umfassend mündlich erläutern lassen.
Mit ihrer Klage hat die Klägerin ihre offene Restwerklohnforderung, die sie mit 3.848,87 € beziffert, geltend gemacht. Die Beklagte hat gegenüber dieser – unbestrittenen – Restwerklohnforderung die Aufrechnung mit gewährleistungsrechtlichen Schadensersatzansprüchen erklärt und widerklagend einen weitergehenden Schadensersatzanspruch von 45.174,13 € geltend gemacht.
Durch sein angegriffenes Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen und der Widerklage in Höhe eines Teilbetrages von 44.742,13 € (nebst Nebenforderungen und Feststellungsausspruch) entsprochen. Zur Begründung hat sich das Landgericht auf die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen gestützt, der eine fehlende Belegreife des Estrichs sowie dessen ungenügende Fugen-/Rissvorbereitung als Ursache der Rissbildungen angenommen hat. Für die danach verfrühte Aufbringung des Monile-Belages trage die Klägerin die Verantwortung. Auf die Einzelheiten der Urteilsbegründung im Übrigen, insbesondere die weiteren rechtlichen Ausführungen sowie tatsächlichen Feststellungen des Landgerichts einschließlich der konkreten Antragstellung der Parteien wird Bezug genommen.
Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten Berufung, mit welcher sie ihre erstinstanzlich geltend gemachte Restwerklohnforderung unter gleichzeitiger Abweisung der Widerklage weiterverfolgt. Das Landgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen dass erst bei der Baubegehung am 28.9.2009 die Risse entstanden seien. Ebenso habe es verkannt, dass die Risse vor allem in jenen Bereichen aufgetreten seien, die als Transportwege für schwere Maschinen dienten. Schon der Sachverständige habe nicht hinreichend gewürdigt, dass entgegen ursprünglicher Planung der Estrich ohne Extruderschaum und ohne doppelte Bewehrung ausgeführt worden sei. Bei der Umsetzung dieses Bau-Solls wären die streitgegenständlichen Risse nicht entstanden. Die Sieblinie habe der Sachverständige nach eigenen Angaben nicht geprüft. Zu Unrecht sei er zudem davon ausgegangen, dass der Monile-Belag bereits zwei Tage – tatsächlich seien es 10 Tage gewesen – nach Verlegung des Estrichs aufgebracht worden sei. Die vom Sachverständigen durchgeführte Probebohrung zeige eine Ausweitung an der Unterseite, was eine ungenügende Lastaufnahme der vorhandenen Estrichkonstruktion bedeute. Ohnehin habe der gerichtliche Sachverständige mit dem hier zu begutachtenden Bodenbelag keine Erfahrung. Das Landgericht habe versäumt, den Sachverständigen zu einer Stellungnahme des Herstellers des Belages ergänzend anzuhören, wonach dieser auf einen tragfähigen Beton und Estrich bis zu einer Restfeuchte von 6 – 8 % verlegt werden könne. Ein klägerseitiges Verschulden habe das Landgericht nicht festgestellt und sei von der Beklagten auch nicht vorgetragen. Auch sei die Widerklageforderung überhöht, da eine nachträgliche Verharzung der Risse im Monile-Belag ausreichend sei, was zu wesentlich geringeren Kosten führen würde. Der erforderliche Austausch des Fußbodenaufbaus im Bereich von Maschinenfundamenten sei von ihr von vornherein nicht zu vertreten. Durch seine Überraschungsentscheidung habe das Landgericht ihr schließlich die Möglichkeit genommen, nochmals ein ausführliches Gegengutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorzulegen, welches die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen widerlegt hätte. Hinsichtlich des Vorbringens im übrigen einschließlich der konkreten Antragstellung wird auf den Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Der Senat beabsichtigt nach Beratung, die Berufung der Klägerin gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen. Der Senat ist nach Prüfung der Sach- und Rechtslage davon überzeugt, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Die Rechtssache hat auch keine grundsätzliche Bedeutung, und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des Berufungsgerichts ebenso wenig wie eine mündliche Verhandlung geboten ist.
Zu Recht und mit zutreffender Begründung, die auch den Angriffen der Berufung standhält, hat das Landgericht hier einen der Beklagten zustehenden Schadensersatzanspruch gemäß §§ 634 Nr. 4, 280 BGB, 13 Nr. 7 Abs. 3 VOB/B 2006 angenommen. Die zentrale Streitfrage, ob es sich bei den unstreitig vorhandenen Rissen des Monile-Belages um Schwindrisse oder Belastungsrisse handele, hat das Landgericht auf Grundlage der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen zutreffend dahingehend entschieden, dass hier von Schwindrissen auszugehen sei (Bl. 164, 374, 468, 474 OH), für welche die Klägerin die Verantwortung trage, während die untersuchten Estrichproben die erforderliche Festigkeit aufgewiesen hätten (Bl. 475 OH).
Als von vornherein nicht zielführend erweisen sich von der Berufungsbegründung bemühte Argumentationslinien, dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen oder auch den landgerichtlichen Tatsachenfeststellungen Annahmen zu unterlegen, auf denen das Gutachten beziehungsweise das Urteil gerade nicht basieren. So findet sich die gerügte „Feststellung“, dass bei der Baubegehung vom 28.9.2009 erstmalig Risse festgestellt worden seien, nicht im landgerichtlichen Urteil. Ebenso wenig basiert die Begutachtung des gerichtlichen Sachverständigen darauf, dass die Klägerin bereits zwei Tage nach Einbringung des Estrichs ihren Belag aufgebracht habe. Zwar findet sich im ursprünglichen Gutachten (Bl. 162 OH) eine entsprechende Annahme der Applikationsfolge. Im Rahmen seiner mündlichen Anhörung hat der Sachverständige indes nur noch hypothetisch einen solchen Sachverhalt unterstellt (Bl. 476 OH) und für diesen fiktiven Fall seine Schlussfolgerungen gezogen. Dabei hat er – von einem normalen unveränderten Zementestrich ausgehend – den Zeitpunkt der Belegreife auf 20 – 28 Tage beziffert, so dass auch der von der Klägerin behauptete Zeitraum von 10 Tagen zwischen Einbringung des Estrichs und Aufbringung des Belags, den der Sachverständige eingangs seiner mündlichen Erläuterungen als Basis angenommen hat (Bl. 466 OH), bei weitem zu kurz gewesen wäre.
Ebenfalls zu Unrecht hält die Klägerin dem Gutachten des Sachverständigen entgegen, das dieser unberücksichtigt gelassen habe, dass die Transportwege mit schwerem Gerät genutzt würden. Dabei ist unstreitig, dass in der Wurstmanufaktur auch ein Fleischkutter sowie ein Füller mit jeweils hohem Eigengewicht betrieben werden; beide Geräte werden indes stationär genutzt, so dass von ihnen keine Belastung der Transportwege ausgeht. Dass – wie vom Sachverständigen angenommen – auf den Transportwegen keine Gabelstapler (oder ähnliche schwere Transportmittel) zum Einsatz gebracht werden, zieht indes auch die Berufung nicht in Zweifel. Sonstige besondere Belastungen der Transportwege sind nicht erkennbar.
Dass der im Objekt verlegte Estrich sowohl hinsichtlich der Dämmschicht wie auch in Bezug auf eine Bewehrung abweichend von den ursprünglichen Planungen ausgeführt worden ist, war dem gerichtlichen Sachverständigen bewusst und wurde von ihm bei seiner Begutachtung berücksichtigt. Dass die tatsächliche Ausbildung des Estrichs belastungsschwächer ausgefallen ist, als dies ursprünglich vorgesehen war, hat auch der Sachverständige bestätigt und in seine Überlegungen einbezogen. Dennoch hat der Sachverständige, der seinem Ausgangsgutachten auch jenes Lichtbild der durchgeführten Probebohrung (Bl. 180 OH, Nr. 26) beigefügt hat, aus welchem die Klägerin nunmehr erstmalig in der Berufungsinstanz – und daher nach § 531 Abs. 2 ZPO ohnehin nicht mehr berücksichtigungsfähig – eine für Belastungsrisse angeblich typische Ausweitung an der Unterseite herleiten möchte, aus dem Gesamtbild der aufgetretenen Risse den Rückschluss gezogen, dass nicht ein zu schwacher Aufbau des Estrichs, sondern die verfrühte Aufbringung des Monile-Belages durch die Klägerin für die in diesem Belag aufgetretenen Risse verantwortlich sei. Dabei hat der Sachverständige in gut nachvollziehbarer – und dem von der Klägerin aus dem Lichtbild 26 gezogenen Schluss entgegenstehender – Weise dargestellt, dass die Bruchflanken der entnommenen Bohrkerne und Platte deutlich zeigten, dass ein Schwindriss und kein Riss in Folge mechanischer Überbelastung vorliege (Bl. 467 f. OH).
Das aufgetretene Schadensbild hätte hier auch nicht durch Einhaltung des Bau-Solls zum ursprünglich geplanten Estrich vermieden werden können. Insoweit hat der gerichtliche Sachverständige bei seiner mündlichen Anhörung erläutert, dass durch eine Bewehrung die Risse hätten geleitet werden können (Bl. 481 OH), so dass dann mehrere kleinere Risse, nicht aber die hier vorhandenen großen Risse aufgetreten wären (ähnliche Folgen schildert der Sachverständige auch für eine veränderte Sieblinie, wobei er auf weitergehende Feststellungen zur Sieblinie bewusst – und aus Sicht des Senats nicht zu beanstandend – verzichtet hat, da die Festigkeit des Estrichs auch ohne solche ergänzenden Prüfungen durch ihn habe hinreichend bestimmt werden können; vgl. Bl. 473 OH). Die Bildung von Schwindrissen hätte hierdurch indes nicht verhindert werden können, so dass auch in diesem Fall seitens der Klägerin die Belegreife des Estrichs hätte abgewartet werden müssen, um ein „Übergreifen“ dieser Mehrzahl von Rissen in den von ihr aufgebrachten Belag zu vermeiden.
Ausweislich der Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen ist der Klägerin zuzugestehen, dass die von den beiden großen, dynamischen Maschinen der Wurstmanufaktur (Fleischkutter und Füller) ausgehenden Schwingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Bereichen die Risscharakteristik und die Rissweiten ungünstig beeinflusst haben (Bl. 166 OH). Die eigentliche Ursache bleiben aber auch hier die aufgrund der verfrühten Aufbringung des Monile-Belages unbearbeitet im Estrich „angelegten“ Schwindrisse, deren Rissbreite durch die Schwingungen vergrößert worden sein mag, die aber auch ohne Hinzutreten dieser Schwingungen sanierungsbedürftig gewesen wären.
Die von der Klägerin erstinstanzlich beigebrachte, ergänzende (schon im selbständigen Beweisverfahren lagen gleichgerichtete Bestätigungen der Herstellerin vor, vgl. Bl. 237, 316 OH) Stellungnahme der Herstellerin des Belages vom 25.5.2012 (Bl. 204 d.A.), dass bereits bei einer Restfeuchte des Estrichs von 6 – 8 % der Monile-Belag verlegt werden könne, gab keine Veranlassung, eine weitere Stellungnahme des gerichtlichen Sachverständigen einzuholen. Vielmehr steht diese Stellungnahme der Herstellerin im Zusammenhang mit der vom Sachverständigen bereits im ursprünglichen Gutachten (Bl. 163 OH) sowie bei seiner Anhörung (Bl. 468 OH) erörterten Frage, inwieweit der Monile-Belag diffusionsoffen beziehungsweise diffusionshemmend sei, also vorhandene Restfeuchte des Estrichs auch nach Aufbringung des Belags noch diffundieren könne. Insoweit hatte der Sachverständige bereits ursprünglich anschaulich dargelegt, dass durch die Aufbringung des Monile-Belages der Diffusionsprozess langsamer ablaufe, wodurch sich das chemische Schwinden über einen längeren Zeitraum erstrecken könne als bei einem beschleunigten Feuchtigkeitsentzug (Bl. 163, 375 f. OH). Unabhängig vom Gehalt an Restfeuchtigkeit bleibt ausweislich der Darstellungen des Sachverständigen aber auch die Oberflächenfestigkeit von Bedeutung (vgl. nur Bl. 479 OH), wobei auch die Herstellerin in ihrer Stellungnahme vom 25.5.2012 einen tragfähigen Estrich voraussetzt, dessen Belegefestigkeit also hinreichend ausgebildet sein muss. Hieran mangelte es nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen hier, da die Bildung der Schwindrisse – unabhängig vom konkreten, von der Klägerin ohnehin nicht belegten Restfeuchtegehalt – im Estrich bei Aufbringung des Monile-Belags noch nicht abgeschlossen war (vgl. Bl. 164, 375 f., 474, 477, 481 OH).
Dabei hat der Sachverständige verdeutlicht, durch welche Maßnahmen die Klägerin eine hinreichende Belegefestigkeit des Estrichs hätte überprüfen können und müssen, nämlich durch Feuchtemessung, Prüfung der Oberflächenfestigkeit, visuelle Begutachtung der geometrischen Verhältnisse und des Aufbaus der Estrichoberfläche (Bl. 479 OH). Bereits vorhandene, estrichtypische Schwindrisse hätten behandelt werden müssen (Bl. 166, 481 OH). Zudem hätte die Klägerin einem noch nicht zum Abschluss gekommenen Schwindprozess durch das systematische Anlegen von Estrichfugen – sei es durch die Klägerin selbst oder den Estrichleger (auf den entsprechenden, von der Klägerin geschuldeten Hinweis hin hätte die Beklagte beim Estrichleger die nachträgliche Anbringung solcher Fugen geltend machen können) – begegnen können und müssen (Bl. 164, 374, 481 OH). Dass die Klägerin hier vor Eintritt der Belegreife des Estrichs bereits den Bodenbelag aufgebracht hat, verstieß danach erkennbar gegen ihre Verpflichtung zur fachgerechten Ausführung des übernommenen Auftrages und bildete damit eine schuldhafte Pflichtverletzung.
Inwieweit der Sachverständige mit dem hier streitgegenständlichen Monile-Belag zuvor möglicherweise noch nicht befasst gewesen war – was die Klägerin letztlich nur mutmaßt, da das Landgericht bei der Anhörung des Sachverständigen die entsprechende Frage nicht zugelassen hatte (Bl. 466 f. OH) -, bleibt unerheblich, da die grundsätzliche Sachkunde des Sachverständigen für Beschichtungen und Kunststoffe im Bauwesen – wozu der Monile-Belag zählt – unbestritten ist und keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass hier Sonderkenntnisse in Bezug auf den konkreten Bodenbelag erforderlich gewesen wären. Auch zur Beurteilung der Festigkeit des eingebauten Estrichs ist der Sachverständige als Leiter der Amtlichen Prüfstelle für nichtmetallische Bau- und Werkstoffe der Fachhochschule …[Y] geeignet.
Die – ebenfalls nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht mehr zu berücksichtigenden, erst nach Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung sowie in der Berufungsinstanz vorgebrachten – Einwände gegen die Höhe der Widerklageforderung verkennen zudem, dass der wesentliche Teil der vom Sachverständigen veranschlagten Kosten darauf zurückzuführen ist, dass hier im laufenden Betrieb einer Wurstmanufaktur, die hohen Hygieneanforderungen genügen muss, in 20 Teilabschnitten die Sanierung durchzuführen sein wird. Auch ist – wie vom Sachverständige überzeugend ausgeführt – eine schlichte Gießtränkung mit Epoxydharz nur als provisorische Sofortmaßnahme ausreichend, während eine dauerhafte Instandsetzung des mangelbehafteten Bodenbelags voraussetzt, dass die Risse einzuschneiden und sodann mit lebensmitteltauglichem EP-Harz zu vergießen sind (vgl. Bl. 165 OH). Die vom Sachverständigen vorgeschlagene Sanierungsmethode ist danach plausibel, gegen die einzelnen von ihm in Ansatz gebrachten Positionen wendet sich die Klägerin der Höhe nach nicht.
Selbst wenn die Klägerin durch das landgerichtliche Urteil überrascht worden sein sollte, kann das Urteil jedenfalls nicht auf einem Verfahrensmangel beruhen. Die Klägerin bringt nämlich auch mit ihrer Berufungsbegründung nicht jenes ausführliche Gegengutachten bei, welches sie angeblich – auf den von ihr als unterlassen gerügten, landgerichtlichen Hinweis hin – vorgelegt hätte.
Da die Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat, legt das Gericht aus Kostengründen die Rücknahme der Berufung nahe. Im Falle der Berufungsrücknahme ermäßigen sich vorliegend die Gerichtsgebühren von 4,0 auf 2,0 Gebühren (vgl. Nr. 1222 des Kostenverzeichnisses zum GKG).
Der Senat beabsichtigt, den Streitwert für die Berufungsinstanz auf 50.591 € festzusetzen.