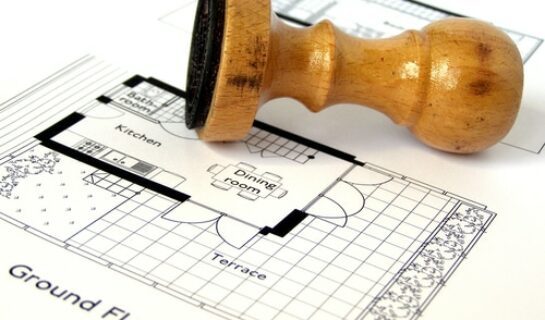LG Krefeld, Az.: 5 O 313/13, Urteil vom 30.12.2016
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 13.919,52 EUR zu zahlen, Zug um Zug gegen die Entfernung der in die zum Wohnhaus der Beklagten gehörende Garage der Liegenschaft……… eingebrachten Dämmplatte und, für den Fall, dass diese beschädigt ist, der Fußbodenheizungsanlage sowie die Erneuerung der Dämmplatte und gegebenenfalls der Fußbodenheizungsanlage mit einer für eine Garagennutzung ausreichenden Drucklastbeständigkeit nebst hierzu erforderlicher Arbeiten zur Ausstemmung und Neuaufbringung des Estrichs.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt. Ausgenommen hiervon sind die Kosten der Streithilfe; diese trägt der Streithelfer selbst.
Das Urteil ist für beide Parteien gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf restlichen Werklohn für die Verlegung einer Fußbodenheizung in Anspruch. Die Beklagte wendet eine mangelhafte Leistungserbringung ein und beruft sich auf ein Zurückbehaltungsrecht.
Im Jahre 2012 beauftragte die Beklagte die Klägerin mit der Lieferung und Montage einer Fußbodenheizung nebst Trittschalldämmung für ein neu zu errichtendes Wohngebäude mit Garage. Grundlage der Vertragsbeziehung war zunächst ein Angebot der Klägerin vom 26.09.2012. Wegen der Einzelheiten nimmt das Gericht Bezug auf die als Anlage K1 zur Klageschrift vom 18.08.2013 eingereichte Ablichtung (Bl. 11 ff. der Gerichtsakten). Im Zuge des Baufortschritts kam es zu Auftragserweiterungen. Die Klägerin stellte der Beklagten verschiedene Rechnungen (in Ablichtung vorgelegt mit Anlagenkonvolut K6 zum Schriftsatz der Klägerin vom 18.07.2014, Bl. 104-118 der Gerichtsakten). Im Februar 2013 leistete die Beklagte eine Zahlung von 8.000,00 EUR. Den Ausgleich der von der Klägerin nach Verrechnung der vorbezeichneten Anzahlung sowie einer Gutschrift auf die Summe der einzelnen offenstehenden Rechnungsbeträge (insoweit nimmt das Gericht Bezug auf die mit Anlage K2 zur Klageschrift in Ablichtung vorgelegte Mahnung vom 02.05.2013, Bl. 14 der Gerichtsakten, die eine entsprechende Aufstellung enthält) darüber hinaus geltend gemachten Zahlungsforderung von 13.919,52 EUR verweigerte die Beklagte indes mit der Begründung, die Klägerin habe im Bereich der Garage eine unzureichende Dämmung eingebracht, die den in einer Garage üblichen Verkehrslasten nicht standhalten würde. Insoweit holte die Klägerin vorprozessual das Gutachten eines privat beauftragten Sachverständigen ein (Anlage KE1 zum Klageerwiderungsschriftsatz vom 18.10.2013, Bl. 39-52 der Gerichtsakten), forderte die Klägerin mit rechtsanwaltlichem Schreiben vom 08.03.2013 unter Fristsetzung zur Mangelbeseitigung auf (Anlage KE2 zum Klageerwiderungsschriftsatz vom 18.10.2013, Bl. 53 f. der Gerichtsakten) und berief sich sodann mit weiterem rechtsanwaltlichem Schreiben vom 10.05.2013 auf ein Zurückbehaltungsrecht (Anlage KE4 zum Klageerwiderungsschriftsatz vom 18.10.2013, Bl. 58 f. der Gerichtsakten).
Die Klägerin behauptet, die von ihr eingebrachte Dämmung sei ausreichend und könne nicht zu Schäden an der Fußbodenheizungsanlage führen. Aufgrund jahrelanger Erfahrung habe sie in Garagen immer die gleiche Dämmung eingebaut, wie bei der Beklagten, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen gekommen sei. Die von ihr verwendete Dämmplatten sei in der Lage, die Druckbelastung eines Fahrzeugs auszuhalten. Stattdessen sei der Estrich mangelhaft erstellt worden, was auch Hintergrund der Beauftragung des Privatsachverständigen durch die Beklagte gewesen sei. Die von der Beklagten behaupteten Mängel hätten zudem bislang zu keinem Schadensbild geführt.
Zuletzt stellt die Klägerin in Abrede, dass die Leistungserbringung in einer Garage überhaupt Gegenstand des zwischen ihr und der Beklagten geschlossenen Werkvertrags gewesen sei; sie, die Klägerin, sei vielmehr von einer Wohnraumnutzung ausgegangen.
Die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an sie 13.919,52 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28.03.2013 zu zahlen.
Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.
Sie behauptet, die Klägerin habe bei den Arbeiten zur Dämmung in der Garage erhebliche Mängel verursacht, deren Beseitigungskosten die Klageforderung überstiegen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Räumlichkeiten sei der Eintritt eines Schadens konkret zu befürchten. Mit Rücksicht hierauf habe sie seinerzeit die Abnahme verweigert und könne sich, so meint die Beklagte, gemäß § 641 Abs. 3 BGB zudem auf ein Leistungsverweigerungsrecht berufen. Sie bzw. der von ihr beauftragte Architekt habe ausdrücklich eine Dämmschicht für die Nutzung der betroffenen Flächen als Garage beauftragt.
Das Gericht hat auf der Grundlage von Beschlüssen vom 18.12.2014 und 12.01.2015 (Bl. 133 f. und 139 f. der Gerichtsakten), vom 15.04.2016 (Bl. 320 ff. der Gerichtsakten) sowie vom 29.08.2016 (Bl. 372 f. der Gerichtsakten) Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens nebst mündlicher Erläuterung. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme nimmt das Gericht Bezug auf das schriftliche Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Installateur- und Heizungsbauerhandwerk V. C. vom 17.07.2015 (Bl. 209 ff. der Gerichtsakten) sowie das Sitzungsprotokoll vom 09.12.2016 (Bl. 388 ff. der Gerichtsakten).
Mit Schriftsatz vom 02.03.2015 hat die Beklagte dem sodann mit Schriftsatz vom 05.04.2015 dem Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin beigetretenen Streithelfer den Streit verkündet.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes nimmt das Gericht Bezug auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteibevollmächtigten nebst Anlagen sowie die Sitzungsniederschriften vom 02.12.2014 (Bl. 123 der Gerichtsakten) und vom 09.12.2016 (Bl. 388 ff. der Gerichtsakten).
Entscheidungsgründe
I.
Die zulässige Klage bleibt im Ergebnis ohne Erfolg. Die Klägerin kann die geltend gemachte Werklohnforderung lediglich beanspruchen, wenn sie die von ihr erbrachte Werkleistung im Hinblick auf den Einbau einer Fußbodenheizung nebst Dämmung im Garagenbereich der Immobilie der Klägerin nachbessert bzw. neu erbringt.
1. Der geltend gemachte Werklohnanspruch der Klägerin ist zunächst aus § 631 Abs. 1 BGB begründet. Die Beklagte schuldet der Klägerin insoweit noch die vereinbarte Vergütung.
a) Die Höhe der im Ergebnis offen stehenden Gesamtrestwerklohnforderung ist, durch die Vorlage der einzelnen Rechnungen sowie die im vorprozessualen Mahnschreiben vom 02.05.2013 enthaltene Aufstellung substantiiert, schlüssig dargetan. Konkrete Einwände gegen die in der Abrechnungsaufstellung enthaltenen Einzelbeträge oder die den betreffenden Rechnungen zugrunde liegenden Leistungen hat die Beklagte nicht vorgebracht. Nach Auffassung des Gerichts ist die von der Klägerin insoweit vorgenommene Abrechnung per Saldierung zuzulassen. Eine konkrete Zuordnung, auf welche Einzelforderungen die ohne Leistungsbestimmung gezahlte Anzahlung von 8.000,00 EUR sowie die Gutschrift von 146,05 EUR zu entfallen haben, ist nicht erforderlich. Dies liefe auf eine bloße Förmelei hinaus, da exakte Tilgungszuordnungen der Anzahlung nach Maßgabe von § 366 Abs. 2 BGB und eine genaue Zuordnung der Gutschrift zu der betreffenden Ursprungsforderung nicht zu einer Veränderung der Gesamtforderung führen würde.
b) Die Beklagte kann der Klägerin nicht entgegenhalten, die Forderung sei gemäß § 641 Abs. 1 BGB mangels Abnahme im Sinne von § 640 BGB nicht fällig. Die Beklagte hat die Werkleistung der Klägerin jedenfalls durch tatsächliche Ingebrauchnahme abgenommen. Soweit sie im Rahmen des Klageerwiderungsschriftsatzes an einer Stelle vorträgt, sie habe seinerzeit die Abnahme verweigert (Schriftsatz vom 18.10.2013, dort Seite 2, Bl. 34 der Gerichtsakten), bleibt dieses Vorbringen ohne jede Substantiierung und steht zudem in Widerspruch dazu, dass sie sich bereits vorprozessual ausdrücklich auf ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 641 Abs. 3 BGB berufen hatte. Zudem hat im Mai 2013, also nachdem die Beklagte bereits einen Mängelbeseitigungsanspruch geltend gemacht und sich auf ein Zurückbehaltungsrecht berufen hatte, der von der Beklagten beauftragte Architekt die Klägerin per E-Mail zur Vorlage von Fachunternehmererklärungen im Hinblick auf eine anstehende Schlussabnahme seitens des Bauordnungsamtes aufgefordert (vgl. E-Mail vom 12.05.2013, vorgelegt mit Anlage K4 zur Klageschrift). Schließlich ist auch auf den Hinweis des Gerichts mit Beschluss vom 15.04.2016 (Bl. 320 der Gerichtsakten), es werde von der Geltendmachung eines Leistungsverweigerungsrechts ausgegangen, kein klarstellender Vortrag der Beklagten erfolgt.
2. Auf ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 641 Abs. 3 BGB beruft sich die Beklagte indes zu Recht.
a) Sie kann die Beseitigung eines Mangels verlangen. Die von der Klägerin im Hinblick auf die eingebaute Fußbodenheizung eingebrachte Dämmung ist sachmangelhaft im Sinne von § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB, jedenfalls aber im Sinne von § 633 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BGB, weil sie nicht die zwischen den Parteien vereinbarte Beschaffenheit bzw. jedenfalls nicht eine Beschaffenheit aufweist, die nach dem zwischen den Parteien geschlossenen Werkvertrag vorausgesetzt war.
aa) Das Gericht hat seiner Bewertung zugrunde gelegt, dass die Parteien insoweit eine Leistungserbringung in einer Garage vertraglich vereinbart haben, die Klägerin also die Lieferung und Montage einer Fußbodenheizung nebst Dämmung für eine Garage schuldet.
(1) Das schriftsätzliche und jedenfalls durch Antragstellung im Termin zur mündlichen Verhandlung am 04.12.2014 in mündlicher Verhandlung vorgetragene Klagevorbringen nimmt an mehreren Stellen ausdrücklich und unmissverständlich Bezug auf eine Leistungserbringung in einer bzw. für eine Garage. Hierin liegt nach Auffassung des Gerichts ein prozessuales Geständnis im Sinne von § 288 Abs. 1 ZPO, sodass das entgegenstehende Behaupten der Beklagten, die vertraglichen Abreden hätten sich hinsichtlich der hier interessierenden Flächen auf eine Garagennutzung bezogen, keines Beweises bedarf. So heißt es beispielsweise im Klagevorbringen der Klägerin an einer Stelle wörtlich, sie, die Klägerin, sei von der Beklagten beauftragt worden, „in der Garage eine Fußbodenheizung zu installieren“ (Schriftsatz vom 16.11.2013, dort Seite 1, Bl. 62 der Gerichtsakten). Ferner führt die Klägerin, wiederum nur beispielsweise, bereits im Rahmen der Klageschrift unmissverständlich aus, sie habe aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung in Garagen immer die gleiche Dämmung eingebaut, wie bei der Beklagten (Klageschrift vom 18.08.2013, dort Seite 3, Bl. 9 der Gerichtsakten).
(2) Überdies ist das im weiteren Prozessverlauf angebrachte Vorbringen der Beklagten, zwischen den Parteien sei keine Leistungserbringung in einer Garage vereinbart gewesen bzw. es sei für sie nicht erkennbar gewesen, dass die zu verlegende Fußbodenheizung sich auch auf Bereiche mit Garagennutzung erstrecke, vor dem Hintergrund des vorstehend auszugsweise zitierten, inhaltlich eindeutigen und unmissverständlichen Sachvortrags widersprüchlich und damit nach den Maßstäben des § 138 Abs. 1 und 2 ZPO unbeachtlich. Wie ausgeführt hat die Klägerin an mehreren Stellen stets und ausdrücklich von einer Leistungserbringung in der Garage und entsprechender Beauftragung gesprochen. Bestärkend hat sie darauf verwiesen, in Garagen stets die gleiche Dämmung wie bei der Beklagten einzubauen. Neben alledem hat sie den im Anschluss an den ersten Termin zur mündlichen Verhandlung ergangenen Beweisbeschluss des Gerichts vom 18.12.2014, der sich ausschließlich zur Fußbodenheizung in der Garage bzw. zur Dämmung in dieser Garage verhält, in dieser Hinsicht unkommentiert gelassen und nicht etwa eingewandt, zu Arbeiten für eine als Garage zu nutzende Räumlichkeit doch überhaupt nicht beauftragt gewesen zu sein. Erst als das Ergebnis der Beweisaufnahme nahelegte, dass hierbei eine unzureichende Dämmung Verwendung gefunden hatte, und der Streithelfer sich auf den Standpunkt stellte, er sei von einer Nutzungsart „Wohnen/Schlafen“ ausgegangen, ist die Klägerin plötzlich darauf verfallen, sie habe von vornherein keine Fußbodenheizung für eine Garage einbauen wollen und sollen. Dies ist angesichts des vorangegangenen – eindeutig und unmissverständlich anderslautenden – Sachvortrags ersichtlich ergebnisgeleitet, unplausibel und widersprüchlich.
(3) Das Vorbringen des Streithelfers veranlasst insoweit nicht zu einer anderen Bewertung, auch nicht unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dessen Vorbringen der von ihm unterstützten Klägerin grundsätzlich zuzurechnen ist. Der Streithelfer hat den Rechtsstreit in der Lage angenommen, in der sich dieser zur Zeit seines Beitritts befunden hat (§§ 74 Abs. 1, 67 ZPO). Der Beitritt erfolgte hier erst nach Anordnung der Beweisaufnahme nach Beginn der mündlichen Verhandlung. Zu diesem Zeitpunkt waren die vorstehend festgestellten Wirkungen des § 288 Abs. 1 ZPO bereits eingetreten. Überdies behauptet auch der Streithelfer nicht explizit bzw. kann mangels eigener Wahrnehmungen nicht behaupten, die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Klägerin und Beklagter hätten sich (ebenfalls) auf eine Wohnraumnutzung bezogen. Sein Vorbringen geht insoweit lediglich unspezifisch dahin, er gehe davon aus, entsprechende Abreden seien auch zwischen Beklagter und Klägerin getroffen worden (Schriftsatz vom 15.04.2015, dort Seite 2, Bl. 177 Gerichtsakten). Vor diesem Hintergrund war auch dem Beweiserbieten auf Vernehmung eines Zeugen (Schriftsatz vom 02.09.2015, dort Seite 4, Bl. 266 der Gerichtsakten) nicht nachzugehen, da der Beweisantritt sich auf das Vorbringen zu vertraglichen Abreden zwischen der Beklagten und dem Streithelfer bezieht und eben nicht auf die hier allein entscheidungserheblichen Abreden zwischen Klägerin und Beklagter.
bb) Die eingebaute Heizungsanlage ist im Hinblick auf die eingebrachte Dämmung unzureichend und eignet sich nicht für eine Verwendung in einer Garage, weil sie insoweit keine ausreichende Drucklastbeständigkeit aufweist. Hinsichtlich dieser Feststellung stützt sich das Gericht auf die nachvollziehbaren und uneingeschränkt überzeugenden Darlegungen des Sachverständigen C. Dieser ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die beim Einbau der Heizungsanlage verwendete Systemplatte in ganz erheblicher Weise, namentlich neunfach, überbelastet ist. Diese sachverständigen Ausführungen sind für das Gericht uneingeschränkt nachvollziehbar und überzeugend. Der Sachverständige hat seine Feststellungen sowohl im Rahmen seiner schriftlichen Begutachtung (Gutachten vom 17.07.2015, dort Seiten 14-16, Bl. 222-224 der Gerichtsakten) wie auch mündlich (Sitzungsprotokoll vom 09.12.2016, dort Seiten 2-4, Bl. 389-391 der Gerichtsakten) durch anschauliche und nachvollziehbare Berechnungen untermauert. Hiernach steht für das Gericht außer Zweifel, dass die Heizungsanlage für eine Verwendung in einer Garage nicht hinreichend drucklastbeständig ist und von daher die die konkrete Gefahr besteht, dass die Dämmung den in einer Garage üblichen Verkehrslasten nicht sicher standhält, aufstehende Fahrzeuge für die Heizungsanlage also schlicht zu schwer sind.
Ob dieser Zustand bereits zu einer Schädigung der Heizungsanlage selbst geführt hat, kann dahinstehen. Geschuldet ist insoweit eine Dämmung, die den mit einer Garagennutzung verbundenen Lasten sicher und dauerhaft standhält. Von daher reicht für die Bejahung eines Sachmangels im Sinne der Regelungen in § 633 Abs. 2 BGB bereits aus, dass ein Schadenseintritt an der Heizungsanlage zu erwarten ist bzw. konkret droht. Dies ist bei einer Überbelastung im dargestellten Umfang (9-fach) zu bejahen, zumal die Verwendung der hier eingesetzten Systemplatte mit Blick auf die beschriebene Überbelastung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht, was schon für sich genommen das Vorliegen eines Sachmangels indiziert (vgl. Sprau, in: Palandt, BGB, 74. Aufl. 2015, § 633 Rn. 6a m.w.N.).
cc) Einer weitergehenden Sachaufklärung durch ergänzende Beweisaufnahme bedurfte es nicht. Der Sachverständige C. hat die entscheidungserheblichen Fragen umfassend und überzeugend beantwortet. Soweit zur vollständigen Beantwortung der seitens der Klägerin erhobenen Einwendungen gegen die schriftliche Begutachtung eine Bauteilöffnung erforderlich gewesen wäre, hat sich das Gericht auf der Grundlage der Regelungen in § 404a Abs. 1 ZPO veranlasst gesehen, den Sachverständigen hiervon abzuhalten, weil die nach den rechtlichen Bewertungen des Gerichts entscheidungserheblichen Tatsachen zur Frage des Vorliegens oder Nichtvorliegens eines Sachmangels im Sinne von § 633 Abs. 2 BGB umfassend geklärt sind. Insoweit sind auch die von der Klägerin gegen das schriftliche Sachverständigengutachten vom 17.07.2015 erhobenen Einwände, soweit entscheidungserheblich, durch die mündliche Anhörung des Sachverständigen im Termin am 09.12.2016 umfassend gewürdigt worden. Soweit Nachfragen oder Einwände der Klägerin nur durch Vornahme einer Bauteilöffnung beantwortet werden konnten, bedurfte es mangels Entscheidungserheblichkeit einer weitergehenden Sachaufklärung indes nicht. Insbesondere kommt es für die im vorliegenden Rechtsstreit zu treffende Entscheidung nicht darauf an, ob, und wenn ja, inwieweit neben den zur Überzeugung des Gerichts mangelbehafteten Werkleistungen der Klägerin möglicherweise auch die Arbeiten anderer mit dem Bodenaufbau in den betreffenden Räumlichkeiten befasster Werkunternehmer, etwa die des als Estrichleger tätig gewordenen Streithelfers, ebenfalls mangelhaft sind.
dd) Die Verpflichtung der Klägerin zur Nachbesserung erstreckt sich auf die damit notwendigerweise einhergehenden Estricharbeiten, die von ihr ursprünglich nicht geschuldet und dementsprechend auch nicht erbracht worden waren. Anerkannterweise schuldet der Werkunternehmer, soweit ihn eine Nacherfüllungsverpflichtung trifft, neben der Beseitigung der Mängel des fehlerhaft erstellten eigenen Werks auch die Vornahme gegebenenfalls erforderlicher Nebenarbeiten außerhalb dieses Werks (vgl. Palandt-Sprau, a.a.O., § 635 Rn. 4 und 6 m.w.N.).
b) Die Beklagte ist auch berechtigt, den mit der Klage geltend gemachten Betrag vollumfänglich zurückzuhalten. Dieser stellt sich als angemessener Teil der Vergütung im Sinne von § 641 Abs. 3 BGB dar. Regelmäßig ist insoweit das Doppelte der für die Beseitigung des festzustellenden Mangels erforderlichen Kosten als angemessen anzusehen (§ 641 Abs. 3 Hs. 2 BGB). Der Sachverständige geht, für das Gericht auch insoweit nachvollziehbar, überzeugend und von den Parteien in diesem Punkt auch nicht angegriffen, von dem Erfordernis einer Neuverlegung der Fußbodenheizung nebst Dämmung und dadurch entstehender Kosten in Höhe von ca. 7.600,00 EUR inklusive Mehrwertsteuer aus. Das Doppelte dieses Betrages übersteigt die von der Beklagten zurückgehaltene Restwerklohnforderung der Klägerin. Gesichtspunkte, die Anlass für ein Abgehen von der Regelvermutung des § 641 Abs. 3 Hs. 2 BGB bieten könnten, sind nicht ersichtlich.
3. Eine Verzinsung der von der Beklagten Zug-um-Zug gegen eine Nachbesserung zu entrichtenden Vergütungsforderung kann die Klägerin nicht beanspruchen, insbesondere nicht aus den §§ 288 Abs. 1, 286 BGB. Das Zurückbehaltungsrecht des Bestellers aus § 641 Abs. 3 BGB schließt – soweit es besteht – seinen Zahlungsverzug aus (Staudinger/Frank Peters/Florian Jacoby [2014] BGB § 641, Rn. 24).
II.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, hinsichtlich des Streithelfers auf § 101 ZPO.
Die Kostenlast beim Zug-um-Zug-Urteil ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu treffen, ausgerichtet daran, inwieweit die Parteien mit ihrem Klage- bzw. Verteidigungsvorbringen letztlich durchdringen (vgl. zum Ganzen: Hensen, Die Kostenlast beim Zug-um-Zug-Urteil, NJW 1999, 395 ff). So betrachtet hat das Verteidigungsvorbringen der Beklagten hier praktisch uneingeschränkt Erfolg. Dass sie die Restwerklohnforderung der Klägerin wird ausgleichen müssen, hat die Beklagte letztlich nicht infrage gestellt. Mit ihrem Verteidigungsvorbringen dringt sie, wenn auch nicht uneingeschränkt in der Begründung, so doch im Ergebnis durch. Die Klägerin hingegen unterliegt mit ihrem Klagebegehren, den Anspruch auf Zahlung restlichen Werklohns bereits verdient zu haben, ohne die erbrachte Werkleistung nachbessern bzw. neu oder nochmals erbringen zu müssen, praktisch vollständig.
Die Entscheidung zur sofortigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Die von der Klägerin Zug-um-Zug geschuldete Gegenleistung hat insoweit unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Herget, in: Zöller, ZPO, 31 Aufl. 2016, § 709 Rn. 6).
Der Streitwert wird auf 13.919,52 EUR festgesetzt.