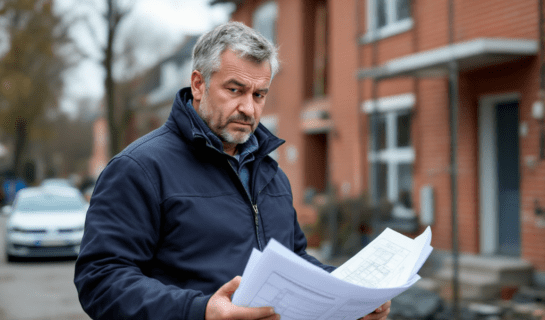Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Kann ein einzelner Satz in einem Vertrag einen millionenschweren Immobiliendeal kippen?
- Was war der Kern des Streits zwischen Käufer und Baufirma?
- Warum hielt der Käufer den Zahlungsplan für eine Falle?
- Wie entschied die erste Instanz und warum gingen beide Parteien in Berufung?
- Warum sah das Kammergericht den Fall völlig anders?
- Wie entkräftete das Gericht die Bedenken des Käufers Punkt für Punkt?
- War der Rücktritt der Baufirma vom Vertrag also wirksam?
- Welches Urteil stand am Ende des langen Rechtsstreits?
- Wichtigste Erkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche Schutzvorschriften müssen Zahlungspläne in Bauträgerverträgen einhalten, um wirksam zu sein?
- Welche Rechte haben Käufer bei Mängeln im Bauvertrag hinsichtlich ihrer Zahlungspflicht?
- Wann können Schadensersatzansprüche aus Vertragsverletzung mit Zahlungsforderungen verrechnet werden?
- Welche Bedeutung haben Abnahme und Übergabe bei einem Bauvertrag für die Fälligkeit von Zahlungen?
- Wann führen fehlerhafte Klauseln in einem Bauvertrag zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 21 U 73/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Kammergericht
- Datum: 20. Mai 2025
- Aktenzeichen: 21 U 73/24
- Verfahren: Berufungsverfahren
- Rechtsbereiche: Bauvertragsrecht (Verträge über Bauvorhaben), Verbraucherschutzrecht (zum Schutz von Käufern bei Bauträgerverträgen)
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Ein Käufer, der mehrere Wohneinheiten von einer Bauträgerin erwarb. Er forderte die Feststellung, dass der Zahlungsplan in seinem Vertrag ungültig sei, und beanspruchte Schadensersatz wegen entgangener Mieteinnahmen.
- Beklagte: Eine Bauträgerin, die sanierte Wohneinheiten verkaufte. Sie verteidigte die Gültigkeit des Zahlungsplans und forderte die Löschung einer Vormerkung im Grundbuch, weil sie vom Vertrag zurückgetreten sei.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Ein Käufer zweifelte die Gültigkeit des Ratenzahlungsplans in seinem Bauträgervertrag an. Er argumentierte, der Plan verstoße gegen Verbraucherschutzvorschriften und mache Zahlungen zu früh fällig.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: War der vereinbarte Ratenzahlungsplan im Kaufvertrag gültig, obwohl er möglicherweise die Regeln zum Schutz der Käufer (Makler- und Bauträgerverordnung) nicht einhielt?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Das Gericht entschied, dass der umstrittene Ratenzahlungsplan im Bauträgervertrag gültig ist. Es sprach dem Käufer (Kläger) einen geringeren Betrag für Mietausfall zu und bestätigte weitere Schadensersatzansprüche. Die Gegenklage der Bauträgerin (Beklagten) wurde abgewiesen.
- Zentrale Begründung: Der Ratenzahlungsplan im Vertrag ist gültig, da seine Regelungen die gesetzlichen Schutzvorschriften für Käufer nicht verletzen und das Recht des Käufers auf Zahlungszurückbehaltung bei Mängeln erhalten bleibt.
- Konsequenzen für die Parteien: Der Käufer muss seine Raten gemäß dem ursprünglichen Vertrag zahlen, erhält aber eine Entschädigung für entgangene Mieteinnahmen; der Rücktritt der Bauträgerin vom Vertrag wurde als unwirksam erklärt.
Der Fall vor Gericht
Kann ein einzelner Satz in einem Vertrag einen millionenschweren Immobiliendeal kippen?
Ein Käufer investierte in neun Wohnungen in einem Berliner Sanierungsprojekt. Ein komplexer Bauträgervertrag regelte den Deal. Doch kurz nach Vertragsbeginn geriet das Projekt ins Stocken. Jahre vergingen, ohne dass die versprochene Wohnung übergeben wurde. Der Käufer verweigerte daraufhin jegliche Zahlung. Er war überzeugt, dass der gesamte Zahlungsplan im Vertrag ungültig war und er erst zahlen müsse, wenn alles fertig ist.

Die Baufirma sah das anders, forderte Geld und erklärte schließlich den Rücktritt vom Vertrag. Der Fall landete vor dem Kammergericht Berlin, das eine grundlegende Frage klären musste: Hält ein moderner Bauträgervertrag den strengen deutschen Verbraucherschutzregeln stand, oder ist er eine Falle für den Käufer?
Was war der Kern des Streits zwischen Käufer und Baufirma?
Im Juli 2019 schlossen die Parteien einen sogenannten Bauträgervertrag. Dies ist eine Mischung aus einem Kaufvertrag für ein Grundstück und einem Werkvertrag für den Bau oder die Sanierung eines Gebäudes darauf. Der Kläger erwarb die Wohnung Nr. 19 für rund 247.000 Euro, die zu diesem Zeitpunkt noch vermietet war. Die Baufirma, die Beklagte, verpflichtete sich, die Wohnung zu sanieren und sie dem Kläger bis zum 31. Januar 2020 bezugsfertig zu übergeben.
Der Vertrag enthielt einen detaillierten Zahlungsplan. Solche Pläne sind in Deutschland streng reguliert durch die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV). Diese Verordnung soll Käufer davor schützen, große Summen im Voraus zu zahlen, während der Baufortschritt ausbleibt. Sie erlaubt dem Bauträger, den Kaufpreis in maximal sieben Raten je nach Baufortschritt zu verlangen.
Der Kläger leistete keine Zahlungen. Auch Jahre nach dem vereinbarten Fertigstellungstermin war die Wohnung nicht übergeben. Als die Baufirma im Februar 2023 eine erste Rate von über 88.000 Euro forderte, weigerte sich der Kläger nicht nur, sondern erklärte die Aufrechnung. Das bedeutet, er verrechnete die Forderung der Baufirma mit eigenen Ansprüchen, nämlich den Mieteinnahmen, die ihm seit dem versäumten Übergabetermin entgangen waren. Die Baufirma erklärte daraufhin den Rücktritt vom Vertrag – sie wollte den gesamten Deal rückabwickeln.
Warum hielt der Käufer den Zahlungsplan für eine Falle?
Der Kläger argumentierte, der gesamte Zahlungsplan sei nichtig, also von Anfang an rechtlich unwirksam. Seine Begründung stützte sich auf drei Hauptpunkte im Vertragstext, die ihn seiner Meinung nach unangemessen benachteiligten:
- Fälligkeit trotz Mängeln: Eine Klausel im Vertrag besagte, dass Mängel am Bau grundsätzlich nichts an der Fälligkeit einer Rate ändern. Der Käufer sah hier eine klare Abweichung vom Schutzgedanken des Gesetzes. Er befürchtete, für mangelhafte Arbeit zahlen zu müssen, ohne ein wirksames Druckmittel zu haben.
- Übergabe erst nach Abnahme: Der Vertrag sah vor, dass der Käufer die Wohnung erst förmlich abnehmen müsse, bevor sie ihm übergeben wird. Die Abnahme ist eine rechtliche Erklärung, mit der der Käufer das Werk im Wesentlichen als vertragsgemäß anerkennt. Der Käufer sah darin eine unzulässige Vorleistungspflicht: Er sollte erst das Werk billigen und erst danach die Schlüssel erhalten.
- Flexibler Ratenplan: Der Plan legte nicht von vornherein fest, welche der zwölf möglichen Bauabschnitte zu welchen der maximal sechs Raten zusammengefasst werden. Der Käufer sah hier einen Verstoß gegen die klare Struktur, die die MaBV zum Schutz des Käufers fordert.
Die rechtliche Konsequenz aus der Sicht des Käufers war weitreichend: Wenn der vertragliche Zahlungsplan nichtig ist, tritt eine gesetzliche Ersatzregelung in Kraft. Nach dieser Regelung, so seine Argumentation, wäre der gesamte Kaufpreis erst dann fällig, wenn die Immobilie nicht nur bezugsfertig, sondern vollständig fertiggestellt ist. Da dies nicht der Fall war, sei er nicht im Zahlungsverzug und der Rücktritt der Baufirma unwirksam.
Wie entschied die erste Instanz und warum gingen beide Parteien in Berufung?
Das Landgericht Berlin gab dem Käufer in den entscheidenden Punkten recht. Es erklärte den Zahlungsplan tatsächlich für nichtig und urteilte, dass der Kaufpreis erst fällig werde, wenn das gesamte Objekt abnahmefähig hergestellt sei. Es verurteilte die Baufirma außerdem zur Zahlung von Schadensersatz für die entgangenen Mieten. Die Widerklage der Baufirma, mit der sie die Löschung der Eigentumsvormerkung des Käufers aus dem Grundbuch erreichen wollte, wies das Gericht ab. Eine solche Vormerkung sichert den Anspruch des Käufers auf die Eigentumsübertragung.
Trotz des Sieges war auch der Käufer nicht vollständig zufrieden. Er wollte eine noch schärfere Regelung: Die Zahlung sollte erst nach vollständiger Fertigstellung fällig sein, nicht nur nach abnahmefähiger Herstellung. Die Baufirma wiederum fühlte sich durch das Urteil komplett falsch behandelt. Sie legte ebenfalls Berufung ein mit dem Ziel, die Klage vollständig abzuweisen und ihren Rücktritt vom Vertrag für wirksam erklären zu lassen. So landete der Fall zur endgültigen Klärung vor dem Kammergericht.
Warum sah das Kammergericht den Fall völlig anders?
Das Kammergericht kippte die zentrale Entscheidung des Landgerichts. Nach eingehender Prüfung der umstrittenen Vertragsklauseln kamen die Richter zu einem klaren Ergebnis: Der Ratenzahlungsplan ist wirksam. Er verstößt nicht gegen die Schutzvorschriften der Makler- und Bauträgerverordnung. Diese Wende veränderte die rechtliche Bewertung des gesamten Falles grundlegend und führte zu einem Urteil, das die Argumente beider Seiten neu gewichtete.
Wie entkräftete das Gericht die Bedenken des Käufers Punkt für Punkt?
Das Gericht nahm sich jede der vom Käufer kritisierten Klauseln vor und erklärte, warum sie aus juristischer Sicht Bestand haben. Die Begründung des Kammergerichts folgte einer präzisen juristischen Logik, die den Schutz des Käufers nicht in den Klauseln selbst, sondern in den allgemeinen gesetzlichen Rechten verortete, die dem Käufer unbenommen bleiben.
- Die Klausel zur Fälligkeit trotz Mängeln: Das Gericht stellte fest, dass diese Klausel den Käufer nicht schutzlos stellt. Sie spiegelt lediglich eine seit 2018 geltende Gesetzesänderung wider. Ein Käufer verliert durch diese Klausel nicht sein wichtigstes Recht: das Zurückbehaltungsrecht. Dies lässt sich mit einem Alltagsbeispiel vergleichen: Bestellt man eine teure Küche und bei der Lieferung fehlt die Arbeitsplatte, ist die Rechnung für die Küche zwar grundsätzlich fällig, aber man darf einen angemessenen Teil des Geldes zurückhalten, bis die Platte nachgeliefert wird. Genau dieses Recht, so das Gericht, blieb dem Käufer unbenommen. Er konnte bei Mängeln einen Teil der Rate einbehalten und war somit ausreichend geschützt.
- Die Klausel zur Übergabe nach Abnahme: Auch hier sah das Gericht keinen unzulässigen Nachteil. Die MaBV regelt, wann Geld fließen darf, aber nicht den genauen Ablauf von Abnahme und Übergabe. Das Gericht betonte, dass eine bezugsfertige Wohnung immer auch abnahmefähig ist. Der Käufer ist nicht gezwungen, blind eine Abnahme zu erklären. Er kann verlangen, die Wohnung zu besichtigen und die Abnahme Zug um Zug gegen die Übergabe der Schlüssel zu erklären. Das ist wie beim Kauf an einer Ladentheke: Ware und Geld wechseln gleichzeitig den Besitzer. Eine unfaire Vorleistungspflicht entstehe dadurch nicht.
- Der flexible Ratenplan: Das Gericht befand auch diesen Punkt für unschädlich. Die MaBV schreibt nur vor, dass der Bauträger nicht mehr als sieben Raten fordern darf. Sie verlangt aber nicht, dass der Vertrag diese Raten von Anfang an starr festlegt. Sollte die Baufirma versuchen, eine achte Rate zu fordern, könnte der Käufer die Zahlung einfach verweigern. Der Schutz des Käufers sei damit gewährleistet.
Zusammenfassend stellte das Gericht fest:
- Die Vertragsklauseln nehmen dem Käufer keine wesentlichen gesetzlichen Schutzrechte weg.
- Das Recht, bei Mängeln Geld zurückzuhalten, bleibt bestehen.
- Der Käufer muss nicht in Vorleistung gehen, da Abnahme und Übergabe gleichzeitig erfolgen können.
- Der Zahlungsplan war somit von Anfang an gültig.
War der Rücktritt der Baufirma vom Vertrag also wirksam?
Diese Frage beantwortete das Gericht mit einem klaren Nein. Obwohl der Zahlungsplan gültig war und die Geldforderung der Baufirma damit grundsätzlich berechtigt, war der Käufer dennoch nicht im Zahlungsverzug. Der Grund dafür lag in seiner Aufrechnung. Die Baufirma hatte die Wohnung nicht fristgerecht übergeben und war seit dem 1. Februar 2020 im Verzug. Dadurch war dem Käufer ein Schaden in Form entgangener Mieteinnahmen entstanden. Mit diesem Schadensersatzanspruch durfte er die Forderung der Baufirma verrechnen.
Da die Aufrechnung wirksam war, hatte der Käufer seine Schuld beglichen – nicht mit Geld, aber mit einer eigenen, berechtigten Forderung. Folglich war er nicht im Zahlungsverzug. Ein wirksamer Rücktritt der Baufirma wegen Zahlungsverzugs war damit ausgeschlossen. Der Bauträgervertrag zwischen den Parteien blieb bestehen.
Welches Urteil stand am Ende des langen Rechtsstreits?
Das Kammergericht fällte ein differenziertes Urteil, das die Rechte und Pflichten beider Seiten neu ausbalancierte. Es stellte fest, dass der Kaufpreisanspruch der Baufirma durch die Aufrechnung des Käufers um rund 21.500 Euro gemindert ist. Das Gericht korrigierte hierbei den vom Landgericht angesetzten Betrag leicht nach unten.
Weiterhin wurde festgestellt, dass die Baufirma dem Käufer alle weiteren Schäden ersetzen muss, die ihm durch die verspätete Übergabe der Wohnung und der Mietansprüche zwischen Februar 2020 und Dezember 2022 entstanden sind.
Die Widerklage der Baufirma auf Löschung der Eigentumsvormerkung wurde abgewiesen, da ihr Rücktritt unwirksam war. Im Ergebnis wurde das Urteil der Vorinstanz maßgeblich geändert. Der Zahlungsplan gilt, aber der Vertrag bleibt bestehen, und die Baufirma muss für ihren Verzug haften. Die Kosten des zweijährigen Rechtsstreits wurden zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei die Baufirma mit 60 % den größeren Anteil zu tragen hat.
Wichtigste Erkenntnisse
Bauträgerverträge müssen sich nicht vor dem Verbraucherschutz verstecken, wenn sie dem Käufer seine wichtigsten Rechte belassen.
- Scheinbare Käuferbenachteiligung wird durch gesetzliche Schutzrechte ausgeglichen: Vertragsklauseln verstoßen nicht gegen den Verbraucherschutz, solange dem Käufer seine wesentlichen gesetzlichen Rechte wie das Zurückbehaltungsrecht bei Mängeln erhalten bleiben.
- Wirksame Aufrechnung verhindert Zahlungsverzug trotz gültiger Forderung: Auch wenn eine Geldforderung berechtigt ist, kann der Schuldner durch Verrechnung mit eigenen Schadensersatzansprüchen seinen Zahlungsverzug vermeiden und damit einen Vertragsrücktritt verhindern.
- Flexible Ratenpläne sind zulässig, wenn die Höchstgrenze gewahrt bleibt: Die Makler- und Bauträgerverordnung verlangt keine starre Vorabfestlegung aller Raten, sondern schützt Käufer durch die Begrenzung auf maximal sieben Teilzahlungen.
Der Schutz von Immobilienkäufern liegt weniger in perfekten Vertragsklauseln als in den unverzichtbaren gesetzlichen Rechten, die kein Vertrag wegbedingen kann.
Benötigen Sie Hilfe?
Ist der Zahlungsplan in Ihrem Bauträgervertrag wirksam? Lassen Sie Ihren individuellen Fall in einer unverbindlichen Ersteinschätzung prüfen.
Das Urteil in der Praxis
Für jeden Bauträger ist dieses Urteil eine Mahnung: Ein wirksamer Zahlungsplan allein sichert noch keinen erfolgreichen Deal. Das Kammergericht hat zwar die Gültigkeit der Zahlungspläne in Bauträgerverträgen gestärkt und vielen Standardformulierungen grünes Licht gegeben.
Doch der Fall zeigt unmissverständlich: Selbst ein glasklarer Zahlungsanspruch ist wertlos, wenn der Bauträger eigene, elementare Pflichten wie die fristgerechte Übergabe massiv verletzt und der Käufer mit berechtigten Gegenansprüchen aufrechnet. Dieses Urteil ist ein deutliches Signal, dass formal korrekte Verträge nur die halbe Miete sind; die tatsächliche Vertragserfüllung und das Wissen um die Verteidigungsrechte des Käufers entscheiden am Ende über Sieg oder Niederlage.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Schutzvorschriften müssen Zahlungspläne in Bauträgerverträgen einhalten, um wirksam zu sein?
Zahlungspläne in Bauträgerverträgen müssen strengen Schutzvorschriften genügen, die sicherstellen, dass Zahlungen grundsätzlich dem Baufortschritt folgen und Käufer vor übermäßigen Vorleistungen geschützt sind. Die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) erlaubt dem Bauträger, den Kaufpreis in maximal sieben Raten zu verlangen, die an definierte Baufortschritte gebunden sind.
Man kann sich dies wie den Kauf einer maßgefertigten Küche vorstellen: Man zahlt nicht den vollen Preis im Voraus, sondern erst dann einen Teil, wenn bestimmte Abschnitte, wie die Lieferung der Schränke oder die Montage, abgeschlossen sind. Fehlt die Arbeitsplatte, darf man einen angemessenen Teil der Zahlung zurückhalten, bis dieser Mangel behoben ist.
Der Schutz des Käufers erfordert dabei keine starre Festlegung jedes einzelnen Bauabschnitts im Voraus. Wichtig ist, dass die maximale Anzahl der Raten eingehalten wird und die Zahlung an tatsächliche Baufortschritte geknüpft bleibt. Auch wenn eine Vertragsklausel die Fälligkeit einer Rate trotz Mängeln vorsieht, verlieren Käufer ihr gesetzliches Zurückbehaltungsrecht nicht. Dieses Recht erlaubt es, bei Mängeln einen Teil des Geldes einzubehalten. Ebenso muss die Übergabe der Immobilie nicht vor der Abnahme erfolgen; beides kann Zug um Zug geschehen, sodass keine unfaire Vorleistung des Käufers nötig ist.
Diese Vorschriften dienen dem umfassenden Schutz von Käufern, indem sie ein Gleichgewicht zwischen der Vertragsfreiheit der Parteien und dem Anspruch auf sichere und transparente Bauvorhaben herstellen.
Welche Rechte haben Käufer bei Mängeln im Bauvertrag hinsichtlich ihrer Zahlungspflicht?
Käufer in einem Bauvertrag können bei Mängeln einen Teil der fälligen Zahlungen zurückhalten. Dieses Recht, auch Zurückbehaltungsrecht genannt, schützt den Käufer umfassend, selbst wenn der Vertrag eine Klausel enthält, die die Fälligkeit der Zahlung trotz Mängeln vorsieht.
Man kann dies mit der Lieferung einer teuren Küche vergleichen: Sollte bei der Übergabe die Arbeitsplatte fehlen, ist die Rechnung für die Küche zwar grundsätzlich fällig. Man darf jedoch einen angemessenen Teil des Geldes zurückhalten, bis die fehlende Platte nachgeliefert und der Mangel damit behoben ist.
Dieses Zurückbehaltungsrecht ist ein wichtiges gesetzliches Schutzrecht für Käufer und ist unabhängig von spezifischen Vertragsklauseln gültig. Auch wenn ein Bauvertrag eine Klausel enthält, die die Fälligkeit einer Rate trotz Mängeln vorsieht – was eine seit 2018 geltende Gesetzesänderung widerspiegelt – verliert der Käufer dadurch sein Recht, einen angemessenen Teil der Zahlung einzubehalten, nicht. Das Gericht hat klargestellt, dass der Käufer bei Mängeln ausreichend geschützt bleibt, indem er diesen Teil der Rate einbehält.
Dieses Vorgehen gewährleistet, dass der Käufer bei festgestellten Mängeln ausreichend geschützt ist und ein Mittel zur Durchsetzung der Mangelbeseitigung besitzt.
Wann können Schadensersatzansprüche aus Vertragsverletzung mit Zahlungsforderungen verrechnet werden?
Schadensersatzansprüche aus Vertragsverletzung können mit Zahlungsforderungen verrechnet werden, wenn die Voraussetzungen für eine sogenannte Aufrechnung erfüllt sind. Eine Aufrechnung ist ein rechtliches Instrument, das es ermöglicht, zwei sich gegenüberstehende Geldforderungen miteinander zu verrechnen, sodass sie erlöschen.
Man kann sich das vorstellen wie bei einem Tauschgeschäft: Wenn Person A Person B etwas schuldet und Person B gleichzeitig Person A etwas schuldet, können diese Schulden oft miteinander verrechnet werden, anstatt dass zwei separate Zahlungen erfolgen. Statt Geld zu überweisen, „bezahlt“ man quasi mit einer eigenen berechtigten Forderung.
Damit eine solche Aufrechnung wirksam ist, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Beide Forderungen müssen gegenseitig sein, das heißt, dieselbe Person muss sowohl Gläubiger als auch Schuldner der jeweiligen Forderung sein. Die Forderungen müssen zudem gleichartig sein, typischerweise also beide Geldforderungen, und sie müssen fällig sein, sprich, der Zeitpunkt der Zahlung muss für beide Forderungen erreicht sein.
Die Aufrechnung hat eine große praktische Bedeutung: Sie schützt den Schuldner davor, in Zahlungsverzug zu geraten, auch wenn eine Forderung des Vertragspartners grundsätzlich berechtigt ist. Durch die wirksame Aufrechnung wird die eigene Schuld getilgt. Dies kann verhindern, dass der Vertragspartner wegen vermeintlichen Zahlungsverzugs vom Vertrag zurücktreten kann, da kein Verzug vorliegt. Die Aufrechnung dient somit als wirksames Verteidigungsmittel, um eigene berechtigte Ansprüche geltend zu machen und gleichzeitig eine Forderung des Gegners zu begleichen.
Welche Bedeutung haben Abnahme und Übergabe bei einem Bauvertrag für die Fälligkeit von Zahlungen?
Abnahme und Übergabe sind bei einem Bauvertrag entscheidende Schritte, die maßgeblich beeinflussen, wann Zahlungen fällig werden. Die Abnahme ist die formelle Anerkennung des Bauwerks als im Wesentlichen vertragsgemäß und ist oft der Zeitpunkt, an dem Risiken auf den Käufer übergehen und die Schlusszahlung fällig wird. Die Übergabe hingegen ist die tatsächliche, physische Aushändigung der Immobilie, zum Beispiel der Schlüssel.
Man kann dies mit einem Kauf an einer Ladentheke vergleichen: Ware und Geld wechseln idealerweise gleichzeitig den Besitzer.
Die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) verbindet Zahlungen an den Baufortschritt und die Abnahme. Sie schreibt jedoch keine feste Abfolge vor, dass die Abnahme zwingend vor der physischen Übergabe erfolgen muss. Wichtig ist, dass ein Käufer nicht gezwungen ist, eine Abnahme zu erklären, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, die Immobilie zu besichtigen und gleichzeitig die Schlüssel zu erhalten. Der Käufer kann die Abnahme Zug um Zug gegen die Übergabe der Schlüssel erklären.
Eine Klausel, die „Übergabe erst nach Abnahme“ vorsieht, stellt somit keine unzulässige Vorleistungspflicht für den Käufer dar, solange er die Möglichkeit hat, die Leistung vor der Abnahme zu prüfen und die Abnahme gleichzeitig mit der Übergabe zu erklären. Diese Regelung stellt sicher, dass der Käufer ausreichend geschützt ist und nicht in Vorleistung tritt, ohne die vertraglich vereinbarte Leistung erhalten oder geprüft zu haben.
Wann führen fehlerhafte Klauseln in einem Bauvertrag zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags?
Fehlerhafte Klauseln in einem Bauvertrag führen nur in sehr seltenen Ausnahmefällen zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags. In der Regel bleibt der Vertrag bestehen, auch wenn einzelne Bestimmungen unwirksam sind.
Man kann sich das wie einen Baum vorstellen: Wenn ein Ast krank ist, schneidet man ihn ab, um den Rest des Baumes zu retten. Nur wenn der Stamm selbst schwer beschädigt ist und der Baum ohne ihn nicht mehr leben könnte, muss der ganze Baum gefällt werden. Ähnlich ist es im Vertragsrecht: Eine einzelne fehlerhafte Klausel ist der kranke Ast, der entfernt oder durch eine gesetzliche Regelung ersetzt wird, während der Vertrag – der Baum – erhalten bleibt.
Das deutsche Recht verfolgt den Grundsatz der Vertragserhaltung. Das bedeutet, es wird alles darangesetzt, einen Vertrag aufrechtzuerhalten, selbst wenn einzelne Klauseln nichtig sind. Ist eine Vertragsklausel unwirksam, tritt an ihre Stelle meist die entsprechende gesetzliche Bestimmung. Der restliche Vertrag behält seine Gültigkeit. Eine Gesamtnichtigkeit des Vertrages wird nur dann angenommen, wenn die unwirksame Klausel so zentral für den Vertrag ist, dass dieser ohne sie keinen Sinn mehr ergeben würde oder die Vertragsparteien ihn ohne diese spezifische Klausel niemals geschlossen hätten. Die Hürde für eine solche Annahme ist sehr hoch.
Dieser Grundsatz schützt die Beteiligten und das Vertrauen in geschlossene Vereinbarungen, indem er verhindert, dass kleinere Mängel ganze Rechtsgeschäfte zerstören, und stellt sicher, dass gesetzliche Schutzrechte, insbesondere für Verbraucher, erhalten bleiben.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Abnahme
Die Abnahme ist eine rechtliche Erklärung, mit der der Käufer das Bauwerk im Wesentlichen als vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme erkennt der Käufer an, dass die erbrachte Leistung den Vertrag erfüllt, auch wenn noch kleinere Mängel vorhanden sein können. Sie ist oft der Moment, ab dem wichtige Fristen laufen und Risiken auf den Käufer übergehen.
Beispiel: Im Fall verlangte der Vertrag, dass der Käufer die sanierte Wohnung erst förmlich abnehmen müsse, bevor sie ihm übergeben wird. Der Käufer sah darin eine unzulässige Vorleistungspflicht, doch das Gericht stellte klar, dass er die Abnahme gleichzeitig mit der Schlüsselübergabe erklären kann.
Aufrechnung
Bei einer Aufrechnung verrechnet man seine eigenen berechtigten Geldforderungen mit den Forderungen des Vertragspartners. Das funktioniert wie ein Tauschgeschäft: Anstatt Geld zu überweisen, „bezahlt“ man mit einer eigenen Forderung. Beide Schulden erlöschen dadurch ganz oder teilweise.
Beispiel: Der Käufer erklärte die Aufrechnung, als die Baufirma 88.000 Euro forderte. Er verrechnete diese Forderung mit seinen eigenen Ansprüchen auf entgangene Mieteinnahmen, die ihm durch die verspätete Übergabe entstanden waren.
Bauträgervertrag
Ein Bauträgervertrag ist eine Mischung aus Grundstückskauf und Bauauftrag in einem einzigen Vertrag. Der Bauträger verkauft nicht nur ein Grundstück, sondern verpflichtet sich gleichzeitig, darauf ein Gebäude zu errichten oder zu sanieren und es dem Käufer fertig zu übergeben.
Beispiel: Der Käufer schloss im Juli 2019 einen Bauträgervertrag über eine Berliner Wohnung für 247.000 Euro. Die Baufirma sollte die noch vermietete Wohnung sanieren und ihm bis Januar 2020 bezugsfertig übergeben.
Eigentumsvormerkung
Eine Eigentumsvormerkung im Grundbuch sichert den Anspruch des Käufers auf die spätere Eigentumsübertragung ab. Sie wirkt wie ein Platzhalter: Selbst wenn der Verkäufer versucht, die Immobilie an jemand anderen zu verkaufen, hat der eingetragene Käufer Vorrang.
Beispiel: Die Baufirma wollte mit ihrer Widerklage erreichen, dass die Eigentumsvormerkung des Käufers aus dem Grundbuch gelöscht wird. Das Gericht lehnte dies ab, da der Rücktritt der Baufirma unwirksam war und der Käufer weiterhin Anspruch auf die Wohnung hatte.
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
Die MaBV schützt Käufer vor übermäßigen Vorauszahlungen bei Immobiliengeschäften. Sie regelt streng, wann und in welcher Höhe Bauträger Geld vom Käufer verlangen dürfen. Maximal sieben Raten sind erlaubt, die jeweils an bestimmte Baufortschritte gekoppelt sein müssen.
Beispiel: Der vom Käufer kritisierte Zahlungsplan musste sich an der MaBV messen lassen. Das Gericht prüfte, ob die umstrittenen Klauseln gegen die Schutzvorschriften dieser Verordnung verstießen, kam aber zum Schluss, dass der Plan wirksam war.
Nichtigkeit
Ein nichtiger Vertrag oder eine nichtige Klausel ist von Anfang an rechtlich unwirksam. Es ist, als hätte man nie einen Vertrag geschlossen oder als würde die entsprechende Klausel nicht existieren. An die Stelle nichtiger Klauseln treten dann meist gesetzliche Regelungen.
Beispiel: Der Käufer argumentierte, der gesamte Zahlungsplan sei nichtig und daher rechtlich unwirksam. Falls das gestimmt hätte, wäre eine gesetzliche Ersatzregelung in Kraft getreten, nach der er erst bei vollständiger Fertigstellung hätte zahlen müssen.
Rücktritt
Ein Rücktritt macht einen Vertrag wieder rückgängig. Die Vertragsparteien müssen dann alles zurückgeben, was sie bereits erhalten haben – als wäre der Vertrag nie geschlossen worden. Ein Rücktritt ist nur unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen möglich.
Beispiel: Die Baufirma erklärte den Rücktritt vom Vertrag, weil der Käufer nicht zahlte. Das Gericht stellte jedoch fest, dass dieser Rücktritt unwirksam war, da der Käufer durch seine wirksame Aufrechnung nicht im Zahlungsverzug stand.
Zurückbehaltungsrecht
Das Zurückbehaltungsrecht erlaubt es, bei Mängeln einen angemessenen Teil der Zahlung einzubehalten. Es funktioniert wie ein Pfand: Man gibt das Geld erst frei, wenn der Vertragspartner seine Leistung ordnungsgemäß erbracht hat.
Beispiel: Das Gericht stellte klar, dass der Käufer trotz der kritisierten Vertragsklausel sein Zurückbehaltungsrecht behielt. Bei Mängeln an der sanierten Wohnung hätte er einen Teil der Rate zurückhalten können, bis diese behoben sind.
Wichtige Rechtsgrundlagen
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
Die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) legt fest, wie Bauträger Zahlungen von Käufern erhalten dürfen, um diese vor Vorleistung zu schützen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die zentrale Frage war, ob der Zahlungsplan im Bauträgervertrag den strengen Schutzvorschriften der MaBV entsprach oder den Käufer unangemessen benachteiligte.
Zurückbehaltungsrecht (§ 641 Abs. 3 BGB)
Das Zurückbehaltungsrecht erlaubt dem Käufer, einen angemessenen Teil der Zahlung einzubehalten, wenn das gekaufte Werk Mängel aufweist.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht stellte klar, dass die Klausel, wonach Raten trotz Mängeln fällig sind, den Käufer nicht schutzlos stellt, da sein gesetzliches Recht, bei Bau-Mängeln einen Teil des Geldes einzubehalten, davon unberührt bleibt.
Aufrechnung (§ 387 BGB)
Die Aufrechnung ermöglicht es, zwei gegenseitige Forderungen miteinander zu verrechnen und so zu tilgen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Käufer konnte seine Forderung auf Schadensersatz (entgangene Mieteinnahmen) wegen der verspäteten Übergabe der Wohnung gegen die Zahlungsforderung der Baufirma aufrechnen, wodurch er nicht in Zahlungsverzug geriet.
Verzug und Rücktritt (§ 286 BGB, § 323 BGB)
Gerät eine Vertragspartei in Zahlungsverzug, kann die andere Partei unter bestimmten Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Baufirma erklärte den Rücktritt vom Vertrag, weil sie den Käufer im Zahlungsverzug wähnte; das Gericht entschied jedoch, dass der Käufer aufgrund der wirksamen Aufrechnung nicht im Verzug war und der Rücktritt daher unwirksam blieb.
Das vorliegende Urteil
KG – Az.: 21 U 73/24 – Urteil vom 20.05.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.