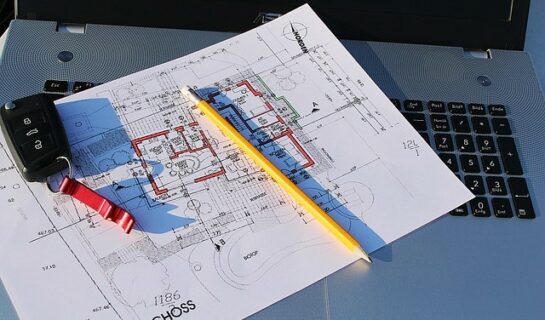Wegen gravierender Schallschutzmängel an einem Doppelhaus forderte ein Käufer in München 206.500 Euro Schadensersatz wegen mangelhafter Werkleistung vom Bauträger. Der Bauunternehmer verzögerte die Mängelbehebung gezielt, um die Ansprüche zu verjähren, doch die Frist begann erst viel später zu laufen.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Warum ging der Bauträger mit seiner Taktik leer aus?
- Welche konkreten Fehler wies das Traumhaus auf?
- Wie wurde der Schaden von 206.500 Euro berechnet?
- Weshalb scheiterte der Bauträger mit seinen Ausreden?
- Warum war der Anspruch des Käufers nicht verjährt?
- Was entschied das Oberlandesgericht München schlussendlich?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Kann ich Schadensersatz verlangen, wenn der Bauträger Baumängel nicht beseitigt?
- Was muss ich tun, bevor ich Schadensersatz statt Mängelbeseitigung fordere?
- Wie wird der Minderwert meiner Immobilie durch Baupfusch genau berechnet?
- Verjähren meine Ansprüche, wenn der Bauträger die Reparatur absichtlich verzögert?
- Muss der Bauträger auch für Mängel haften, die durch fehlerhafte Pläne entstehen?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 28 U 1226/23 Bau | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht München
- Datum: 25.07.2023
- Aktenzeichen: 28 U 1226/23 Bau
- Verfahren: Zurückweisung einer Berufung
- Rechtsbereiche: Werkvertragsrecht, Schadensersatz
- Das Problem: Ein Bauherr forderte von der Baufirma 206.500 Euro Schadensersatz wegen gravierender Mängel an seinem Doppelhaus und der Tiefgarage. Die Mängel betrafen unter anderem den Schallschutz und die Nutzung des Gartens. Die Baufirma weigerte sich zu zahlen und legte Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil ein.
- Die Rechtsfrage: Muss die Baufirma den geforderten Schadensersatz wegen der Mängel bezahlen und sind diese Ansprüche überhaupt noch gültig?
- Die Antwort: Ja. Das Gericht wies die Berufung der Baufirma zurück und bestätigte den Schadensersatz von 206.500 Euro wegen Werteinbuße der Immobilie. Die Ansprüche waren nicht verjährt, da das Abrechnungsverhältnis rechtzeitig entstand.
- Die Bedeutung: Bauunternehmer haften für schwere Mängel und tragen das Risiko für Planungsfehler oder Abweichungen von der vertraglichen Leistung. Bei gravierenden Mängeln wird der Schaden anhand der gesamten Werteinbuße der Immobilie berechnet.
Der Fall vor Gericht
Warum ging der Bauträger mit seiner Taktik leer aus?
Im Immobiliengeschäft ist Zeit Geld. Ein Bauträger aus München schien auf diese Weisheit zu setzen, als er über Jahre hinweg die Mängelbeseitigung an einem neuen Doppelhaus verweigerte. Die Hoffnung: Vielleicht verjähren die Ansprüche des Käufers, vielleicht steigen die Immobilienpreise so stark, dass die Fehler im Vergleich unbedeutend werden.

Dieser Poker ging nicht auf. Das Oberlandesgericht München machte dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung und stellte klar: Wer auf Zeit spielt, trägt am Ende selbst das Risiko. Der Fall wurde zu einer Lektion darüber, ab welchem exakten Moment ein Bauherr die Geduld verlieren und stattdessen Geld verlangen darf.
Welche konkreten Fehler wies das Traumhaus auf?
Die Liste der Mängel war lang und traf den Käufer an empfindlichen Stellen. Der Garten, als freie Wiese versprochen, wurde durch ein unschönes Entlüftungshäuschen für die Tiefgarage verstellt – ein Bauwerk, das zudem im Gemeinschaftseigentum stand und die private Nutzung zunichtemachte. Die Tiefgarage selbst litt unter einem fehlerhaften Lüftungskonzept. Statt einer mechanischen Anlage, wie in der Baugenehmigung vorgesehen, gab es nur eine natürliche Lüftung. Ein weiterer, zentraler Streitpunkt war der Schallschutz. Der Käufer konnte Gespräche und Geräusche aus der benachbarten Doppelhaushälfte hören, weil die gesetzlichen Mindestanforderungen nicht eingehalten wurden. Kleinere Mängel an der Außentreppe rundeten das Bild eines mangelhaften Werks ab.
Wie wurde der Schaden von 206.500 Euro berechnet?
Der Käufer verlangte keinen Kostenvorschuss für Reparaturen. Sein Argument war einfacher: Das Haus ist mit diesen Fehlern auf dem Markt weniger wert. Um diese Werteinbuße zu beziffern, schaltete das Gericht einen Sachverständigen ein. Dessen Methode war logisch. Er ermittelte den fiktiven Marktwert des Hauses, wenn es denn mängelfrei wäre. Anschließend schätzte er den realen Verkaufspreis, den man für das Haus mit all seinen Fehlern erzielen könnte. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten ergab den Schaden – die exakten 206.500 Euro. Das Gericht folgte dieser Berechnung. Es betonte, dass der Käufer einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung hat, geregelt in § 634 Nr. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die Mängel waren so gravierend und betrafen die Kernqualitäten des Wohnens, dass sie sich nicht einfach zu einer Summe kleinerer Ärgernisse addierten. Sie bildeten einen Systemfehler, der den Gesamtwert der Immobilie drückte.
Weshalb scheiterte der Bauträger mit seinen Ausreden?
Der Bauträger versuchte, die Verantwortung von sich zu weisen. Er argumentierte, die Planvorgaben für die Lüftung seien fehlerhaft gewesen. Das Gericht pulverisierte dieses Argument. Ein Fachunternehmen wie der Bauträger hat eine Prüf- und Hinweispflicht. Hätte er die Pläne als unausführbar erkannt, wäre es seine Aufgabe gewesen, auf den Käufer zuzugehen und eine Lösung zu finden – nicht, eigenmächtig eine minderwertige Alternative zu bauen. Ähnlich klar war die Position der Richter beim Schallschutz. Der Bauträger behauptete, der Nachbar habe schallschutzrelevante Arbeiten in Eigenregie ausgeführt und sei daran schuld. Das Gericht sah das anders. Der Bauträger schuldete dem Käufer ein Haus, das den zugesagten Schallschutzstandards entspricht. Er hätte dem Nachbarn niemals Arbeiten gestatten dürfen, die diesen Erfolg gefährden. Das Risiko für das Verhalten Dritter lag allein beim Bauträger.
Warum war der Anspruch des Käufers nicht verjährt?
Hier lag der Kern des Falles. Der Bauträger erhob die Einrede der Verjährung nach § 214 BGB und hoffte, der Käufer habe zu lange gewartet. Die Richter sahen das anders und definierten einen entscheidenden Wendepunkt. Solange der Käufer auf eine Reparatur hoffen kann und dem Bauträger Fristen zur Nachbesserung setzt, befindet man sich noch im Stadium der Vertragserfüllung. Weigert sich der Bauträger aber endgültig oder lässt die letzte gesetzte Frist verstreichen, wandelt sich das Vertragsverhältnis. Ab diesem Moment entsteht ein sogenanntes Abrechnungsverhältnis. Der Käufer muss die Mängel nicht mehr hinnehmen – er kann stattdessen Geld als Ausgleich fordern. Das Gericht legte diesen Zeitpunkt auf den 20. November 2020 fest, den Tag, an dem die letzte Frist zur Mängelbeseitigung ablief. Die Klage des Käufers kam danach rechtzeitig. Die Botschaft des Gerichts war unmissverständlich: Ein Bauträger, der die Mängelbeseitigung verzögert, kann sich nicht darauf berufen, dass die Zeit für ihn arbeitet. Er trägt das wirtschaftliche Risiko, wenn der Schaden im Laufe des Streits anwächst.
Was entschied das Oberlandesgericht München schlussendlich?
Der 28. Zivilsenat des Oberlandesgerichts stufte die Berufung des Bauträgers als offensichtlich aussichtslos ein. Er wies sie per Beschluss nach § 522 der Zivilprozessordnung (ZPO) zurück, ohne eine weitere mündliche Verhandlung anzusetzen. Die Argumente des Bauträgers seien nicht stichhaltig, der Vortrag teils unsubstantiiert und neue Beweismittel aus alten Verfahren prozessual unzulässig. Die Richter bestätigten das Urteil der Vorinstanz in vollem Umfang. Der Bauträger wurde zur Zahlung von 206.500 Euro nebst Zinsen verurteilt. Er muss außerdem die gesamten Kosten des jahrelangen Rechtsstreits tragen. Die Entscheidung zementierte die Haftung des Bauunternehmers für die von ihm geschaffenen Mängel und machte deutlich, dass strategisches Zögern am Ende teuer werden kann.
Die Urteilslogik
Wer als Bauträger auf Zeit spielt und die Mängelbeseitigung strategisch verzögert, riskiert, dass sich der Anspruch des Käufers von der Nachbesserung hin zum vollen, marktwertabhängigen Schadensersatz verschiebt.
- [Verzögerung als Eigentor]: Weigert sich der Bauunternehmer endgültig oder lässt er die gesetzte Nachbesserungsfrist verstreichen, wandelt sich das Vertragsverhältnis in ein Abrechnungsverhältnis, das den Weg für Schadensersatz statt der Leistung freimacht.
- [Berechnung des Sachschadens]: Käufer berechnen den Schaden bei gravierenden Baumängeln, indem sie die gesamte Werteinbuße der Immobilie geltend machen und den mangelfreien Marktwert dem aktuellen, mangelhaften Marktwert gegenüberstellen.
- [Erweiterte Prüf- und Erfolgspflicht]: Bauunternehmer tragen die Pflicht, unausführbare oder fehlerhafte Planungen frühzeitig zu erkennen und anzuzeigen; sie haften zudem für Dritte, deren Handeln den vertraglich zugesicherten Erfolg (wie etwa den erforderlichen Schallschutz) gefährdet.
Das Gericht betont, dass das Risiko für strategisches Zögern und die daraus resultierende Wertminderung der Immobilie vollständig beim Bauunternehmer verbleibt.
Benötigen Sie Hilfe?
Haben Sie Anspruch auf Schadensersatz wegen erheblicher Mängel an Ihrer Immobilie? Kontaktieren Sie uns, um eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihres baurechtlichen Falls zu erhalten.
Experten Kommentar
Wer im Bauprozess auf Verjährung pokert und die Nachbesserung verweigert, spielt mit einem Feuer, das der Bauunternehmer selbst entfacht hat. Dieses Urteil zeigt konsequent: Sobald die letzte Frist zur Mängelbeseitigung abläuft, ist Schluss mit der Hinhaltetaktik. Der Käufer muss fortan keine Reparaturen fordern, sondern kann sofort die Werteinbuße als reinen Schaden geltend machen. Berechnet wird dieser Betrag als die Differenz zwischen mangelfreiem und mangelhaftem Zustand der Immobilie, was dem Bauherrn ein teures strategisches Zögern quittiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Kann ich Schadensersatz verlangen, wenn der Bauträger Baumängel nicht beseitigt?
Ja, der Gesetzgeber bietet Ihnen eine klare Option: Sie können Schadensersatz statt der Leistung fordern. Dieser Anspruch nach § 634 Nr. 4 BGB greift, sobald der Bauträger die Mängelbeseitigung nach Ablauf einer wirksam gesetzten Frist endgültig verweigert. Dies ist der juristische Wendepunkt, an dem sich Ihr Verhältnis vom primären Reparaturanspruch in einen monetären Ausgleich wandelt. Sie müssen nicht länger auf leere Versprechen warten.
Der Grund für diesen Anspruch liegt darin, dass der Bauvertrag auf die Herstellung eines mangelfreien Werkes ausgerichtet ist. Kann oder will der Bauträger diesen vertraglich geschuldeten Zustand nicht herstellen, soll der Käufer nicht auf Dauer in einem mangelhaften Haus festsitzen. Durch das fruchtlose Verstreichen der Frist entsteht das sogenannte Abrechnungsverhältnis. Sie können nun direkt einen finanziellen Ausgleich für den erlittenen Wertverlust fordern, anstatt weiterhin die Nacherfüllung zu verlangen.
Dieser Schadensersatz wird konkret als Minderwert der Immobilie berechnet. Ein Sachverständiger ermittelt die Differenz zwischen dem fiktiven Marktwert des mangelfreien Hauses und dem tatsächlichen Verkaufspreis mit den vorhandenen Fehlern. Gerichte folgen dieser Methode insbesondere bei gravierenden Mängeln wie unzureichendem Schallschutz oder fehlerhaften Lüftungskonzepten. Solche Fehler, die die Kernqualitäten des Wohnens betreffen, werden als Systemfehler gewertet und rechtfertigen einen hohen monetären Ausgleich.
Suchen Sie alle Korrespondenzen und Fristsetzungen heraus, um den exakten Tag zu dokumentieren, an dem Ihr Anspruch vom Reparatur- zum Geldanspruch gewechselt ist.
Was muss ich tun, bevor ich Schadensersatz statt Mängelbeseitigung fordere?
Bevor Sie Schadensersatz statt Mängelbeseitigung verlangen, müssen Sie den Bauträger zwingend formell in Verzug setzen. Sie müssen ihm eine letzte, angemessene Frist zur Behebung der Baumängel einräumen. Erst wenn diese Frist fruchtlos abläuft, wandelt sich Ihr ursprünglicher Anspruch auf Reparatur in eine monetäre Forderung um. Dieser juristisch zwingende Schritt ist essenziell, um Ihren späteren Anspruch rechtssicher zu begründen.
Der Gesetzgeber verlangt diesen formellen Zwischenschritt, weil die Mängelbeseitigung die primäre Vertragspflicht des Bauträgers darstellt. Er muss die Chance erhalten, seine Leistung doch noch vertragsgemäß zu erfüllen, bevor Sie monetäre Ansprüche geltend machen. Das Verstreichen der klaren Frist signalisiert juristisch die endgültige Verweigerung der Leistung. Ab diesem Wendepunkt entsteht das sogenannte Abrechnungsverhältnis, das die Grundlage für Ihren Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung bildet.
Dokumentieren Sie die Fristsetzung sorgfältig, idealerweise per Einschreiben mit Rückschein oder Fax mit Sendeprotokoll. Vermeiden Sie vage Formulierungen in E-Mails wie „Bitte reparieren Sie dies bald“, denn das Schreiben benötigt ein exaktes Enddatum. Gerichte werden diesen Tag später nutzen, um den genauen Beginn des Abrechnungsverhältnisses festzulegen. Diese klare Fristsetzung dient auch als wichtiger Hebel, um zu verhindern, dass der Bauträger sich später auf die Verjährung beruft.
Listen Sie alle Baumängel präzise im Schreiben auf und setzen Sie eine realistische Frist von maximal drei Wochen zur vollständigen Behebung.
Wie wird der Minderwert meiner Immobilie durch Baupfusch genau berechnet?
Der objektive Minderwert Ihrer Immobilie wird nicht durch geschätzte Reparaturkosten, sondern über die Werteinbuß-Methode bestimmt. Dazu ermittelt ein unabhängiger Sachverständiger den tatsächlichen, messbaren Schaden. Die Berechnung stellt den fiktiven Wert der Immobilie in mangelfreiem Zustand dem aktuellen Wert mit den vorhandenen Fehlern gegenüber.
Die Regel: Die Berechnung fußt auf der Annahme, dass eine Immobilie mit gravierenden Mängeln auf dem Markt schlichtweg weniger wert ist. Gerichte ziehen diese Methode vor, wenn Mängel wie schlechter Schallschutz oder eine fehlerhafte Lüftungsanlage tiefgreifende Systemfehler darstellen. Solche Fehler sind oft nur schwer oder gar nicht durch Nachbesserung zu beheben, weshalb die reine Reparaturforderung oft wenig sinnvoll ist. Der Sachverständige ermittelt, welchen fiktiven Kaufpreis das Haus ohne Pfusch erzielt hätte.
Konkret zieht der Gutachter den aktuellen realen Marktwert der mangelhaften Immobilie von diesem fiktiven Marktwert ab. Die Differenz aus dieser Gegenüberstellung ist der messbare, monetäre Schaden, der Ihnen zusteht. In einem bekannten Fall vor dem OLG München ergab diese Methode exakt 206.500 Euro Schadensersatz, da das Haus wegen fehlender Schallschutzstandards und eines störenden Entlüftungshäuschens dauerhaft weniger nutzbar war.
Erstellen Sie eine Liste aller Mängel, welche die Nutzbarkeit oder gesetzliche Vorgaben dauerhaft betreffen, um das Gutachten vorzubereiten.
Verjähren meine Ansprüche, wenn der Bauträger die Reparatur absichtlich verzögert?
Die Befürchtung, dass strategisches Zögern des Bauträgers zu einer Verjährungsfalle wird, ist unbegründet. Solange Sie dem Bauträger weiterhin Fristen zur Mängelbeseitigung setzen, bleibt Ihr ursprünglicher Anspruch aktiv. Das Gesetz schützt Bauherren davor, dass ihre Geduld juristisch bestraft wird. Gerichte sehen diese Phase weiterhin als Stadium der Vertragserfüllung an, nicht als den Beginn der Verjährung.
Der juristische Wendepunkt tritt erst dann ein, wenn der Bauträger die letzte, angemessen gesetzte Frist zur Nachbesserung ignoriert oder die Leistung endgültig verweigert. Bis zu diesem Moment versuchen die Vertragspartner weiterhin, den Werksvertrag zu erfüllen. Die maßgebliche Verjährungsfrist für den anschließenden Schadensersatzanspruch beginnt demnach erst mit dem Tag, an dem die letzte Frist fruchtlos abläuft. Dies verhindert wirksam, dass der Bauträger von seinem eigenen Zeitspiel profitiert.
Ein Bauträger, der die Mängelbeseitigung absichtlich verzögert, kann sich später nicht darauf berufen, dass die Zeit für ihn gearbeitet hätte. Er trägt stattdessen das volle wirtschaftliche Risiko. Konkret: Falls der Schaden oder der Minderwert der Immobilie im Laufe der Verzögerungszeit anwächst, haftet der Bauträger für den erhöhten Betrag. Solange der Käufer noch auf eine Reparatur hofft, bleibt der primäre Nacherfüllungsanspruch bestehen.
Nehmen Sie dem Bauträger keine unbegrenzten mündlichen Zusagen ab, sondern dokumentieren Sie jede finale Fristsetzung schriftlich.
Muss der Bauträger auch für Mängel haften, die durch fehlerhafte Pläne entstehen?
Ja, der Bauträger kann sich nicht damit herausreden, dass die Baupläne fehlerhaft waren oder vom Architekten stammten. Als Fachunternehmen trägt der Bauträger die juristische Verantwortung für das fertiggestellte Werk. Er schuldet dem Käufer stets eine mangelfreie Immobilie, unabhängig davon, wer die Planungsfehler ursprünglich verursachte.
Der zentrale Grund dafür ist die sogenannte Prüf- und Hinweispflicht. Ein Bauunternehmer muss die ihm vorgelegten Pläne sorgfältig auf ihre technische Umsetzbarkeit und Mangelfreiheit überprüfen. Hätte der Bauträger die Fehlerhaftigkeit der Pläne erkennen müssen – etwa weil sie gegen baurechtliche Normen verstießen oder zur Unausführbarkeit führten – hätte er den Käufer warnen müssen. Er darf keinesfalls eigenmächtig eine minderwertige Bauweise umsetzen, nur weil die Pläne mangelhaft waren.
Ein Beispiel: Im Fall des OLG München versuchte der Bauträger, die Schuld für ein fehlerhaftes Lüftungskonzept auf den Planer abzuwälzen. Das Gericht wies dies zurück, da der Bauträger als Experte hätte erkennen müssen, dass die geplante natürliche Lüftung nicht die in der Baugenehmigung geforderte mechanische Lüftung ersetzen konnte. Der Bauträger trägt zudem das volle Risiko für das Verhalten Dritter, seien es Subunternehmer oder Nachbarn, die vertraglich zugesicherte Standards wie den Schallschutz gefährden.
Fordern Sie die Baugenehmigung und alle Fachplanungen an, um exakt zu dokumentieren, welche vertraglichen Standards unterschritten wurden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Abrechnungsverhältnis
Das Abrechnungsverhältnis entsteht in der Baujuristik genau in dem Moment, in dem der Käufer die primäre Mängelbeseitigung nicht mehr verlangt, sondern stattdessen einen monetären Ausgleich fordert. Dieses spezielle Verhältnis löst den ursprünglichen Nacherfüllungsanspruch ab und bildet die juristische Grundlage dafür, dass Bauherren ihre Ansprüche finanziell abrechnen können, anstatt ewig auf Reparaturen warten zu müssen.
Beispiel: Nachdem die letzte Nachbesserungsfrist am 20. November 2020 fruchtlos verstrichen war, wechselte das Vertragsverhältnis automatisch in das Abrechnungsverhältnis, wodurch der Käufer nun Schadensersatz fordern durfte.
Beschluss nach § 522 ZPO
Ein Beschluss nach § 522 der Zivilprozessordnung (ZPO) ist das scharfe Schwert, mit dem Oberlandesgerichte eine Berufung zügig zurückweisen, wenn sie diese als offensichtlich aussichtslos einstufen. Dieses Verfahren dient der Verfahrensökonomie und beschleunigt den Abschluss von Rechtsstreitigkeiten; es erlaubt dem Gericht, auf eine teure und langwierige mündliche Verhandlung zu verzichten.
Beispiel: Der 28. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München wies die Berufung des Bauträgers per Beschluss nach § 522 ZPO zurück, weil dessen juristischer Vortrag unsubstantiiert und nicht stichhaltig war.
Prüf- und Hinweispflicht
Die Prüf- und Hinweispflicht ist die gesetzliche Verantwortung eines Bauträgers oder Bauunternehmers, ihm vorgelegte Pläne und Anweisungen sorgfältig auf ihre technische Korrektheit und mögliche Mangelhaftigkeit zu überprüfen. Juristen stellen damit sicher, dass Fachunternehmen ihr Expertenwissen nutzen, um den Bauherrn vor Planungsfehlern oder ungeeigneten Baumaterialien zu schützen, bevor Schäden entstehen.
Beispiel: Der Bauträger hätte aufgrund seiner Prüf- und Hinweispflicht erkennen müssen, dass die Baupläne eine natürliche Lüftung vorsahen, obwohl die Baugenehmigung zwingend eine mechanische Lüftung für die Tiefgarage erforderte.
Schadensersatz statt der Leistung
Juristen nennen Schadensersatz statt der Leistung den Anspruch, der dem Käufer zusteht, wenn der Verkäufer (oder Bauträger) nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Frist seine geschuldete vertragliche Leistung endgültig nicht erbringt oder behebt. Dieser monetäre Anspruch wandelt den primären Reparaturanspruch in eine reine Geldforderung um und erlaubt dem Geschädigten, sich finanziell so zu stellen, als wäre das mangelfreie Werk geliefert worden.
Beispiel: Der Käufer forderte Schadensersatz statt der Leistung in Höhe von 206.500 Euro, weil das Doppelhaus aufgrund des fehlenden Schallschutzes und der fehlerhaften Tiefgarage einen erheblichen Minderwert aufwies.
Systemfehler
Als Systemfehler klassifizieren Gerichte im Baurecht gravierende Kernmängel an einer Immobilie, die die Nutzung substanziell beeinträchtigen oder schwerwiegende Normverstöße darstellen und oft kaum repariert werden können. Die juristische Bewertung als Systemfehler ist entscheidend, da solche tiefgreifenden Mängel nicht als Summe kleinerer Ärgernisse gelten, sondern den gesamten Marktwert der Immobilie drastisch mindern.
Beispiel: Die fehlerhafte Lüftung der Tiefgarage und der mangelhafte Schallschutz zwischen den Doppelhaushälften wurden vom Oberlandesgericht München als Systemfehler gewertet, welche die Kernqualitäten des Wohnens betrafen.
Verjährung (Einrede der Verjährung)
Die Verjährung beschreibt den juristischen Mechanismus, wonach ein Anspruch zwar weiterhin besteht, der Schuldner ihn aber nach Ablauf einer gesetzlichen Frist durch die Einrede der Verjährung nicht mehr erfüllen muss. Dieses Institut schafft Rechtsfrieden und Rechtssicherheit, indem es verhindert, dass alte Ansprüche unbegrenzt geltend gemacht werden können und der Schuldner ewig in Ungewissheit verbleibt.
Beispiel: Der Bauträger erhob die Einrede der Verjährung nach § 214 BGB in der Hoffnung, der Käufer habe zu lange gewartet, scheiterte jedoch, weil die Verjährungsfrist erst mit dem Ende der letzten gesetzten Nachbesserungsfrist begann.
Das vorliegende Urteil
OLG München – Az.: 28 U 1226/23 Bau – Beschluss vom 25.07.2023
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.