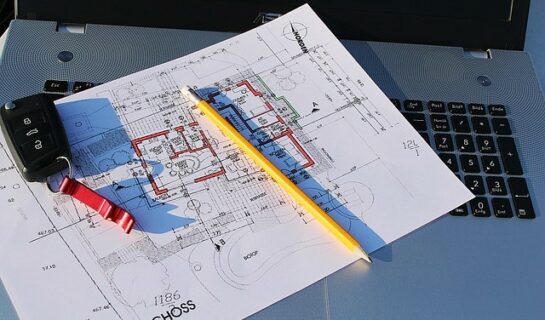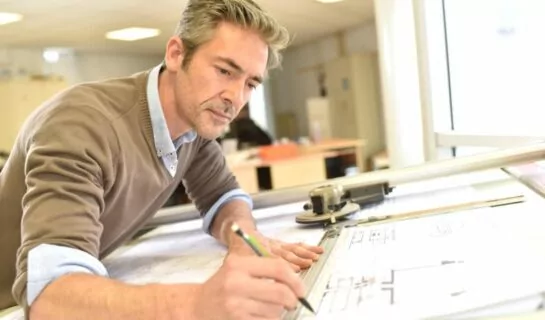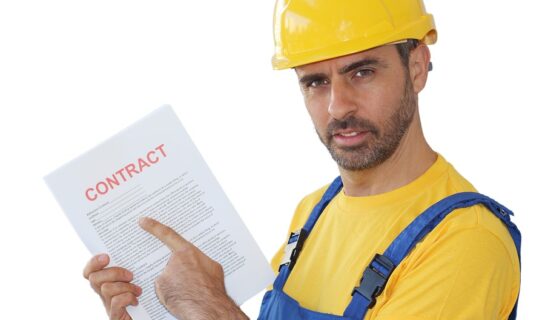Eine Wohnungseigentümergemeinschaft forderte fast eine halbe Million Euro von einem Architekten wegen gravierender Schallschutzmängel in Neubauwohnungen. Doch obwohl die Mängel klar belegt waren, scheiterte die Klage an einem entscheidenden Detail aus der Vergangenheit.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Warum klagte eine Wohnungseigentümergemeinschaft wegen Schallschutzmängeln gegen den Architekten?
- Wie versuchte die WEG, die Schadensersatzansprüche des Bauträgers geltend zu machen?
- Weshalb argumentierte der Architekt, dass kein ersatzfähiger Schaden entstanden sei?
- Warum wies das Oberlandesgericht die Klage trotz der Schallschutzmängel ab?
- Weshalb half der Klägerin das Argument der fiktiven Mängelbeseitigungskosten nicht?
- Warum ließ das Gericht die Revision zum Bundesgerichtshof zu?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet die Verjährung für meine Mängelansprüche am Bau?
- Kann ich abgetretene Bau-Mängelansprüche noch durchsetzen?
- Gilt Verjährung auch für meinen Bau-Schadensersatzanspruch?
- Wie kann ich Bau-Mängelansprüche richtig abtreten lassen?
- Reichen fiktive Mängelbeseitigungskosten für meinen Bau-Schaden aus?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 8 U 193/22 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Eine Gruppe von Wohnungseigentümern klagte gegen einen Architekten. Es ging um mangelhaften Schallschutz in ihren Wohnungen.
- Die Rechtsfrage: Hatte die Baufirma überhaupt einen Schaden, den sie an die Eigentümergemeinschaft abtreten konnte?
- Die Antwort: Nein. Die Baufirma hatte selbst keinen Schaden, weil Ansprüche gegen sie schon verjährt waren. Daher gab es auch keinen Schaden, der an die Eigentümergemeinschaft übergehen konnte.
- Die Bedeutung: Ein Anspruch kann nur abgetreten werden, wenn der ursprüngliche Gläubiger selbst einen Schaden hatte. Dies ist nicht der Fall, wenn die Forderungen gegen ihn bereits verjährt sind.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Oberlandesgericht Braunschweig
- Datum: 31.07.2025
- Aktenzeichen: 8 U 193/22
- Verfahren: Berufungsverfahren
- Rechtsbereiche: Werkvertragsrecht, Verjährungsrecht, Zivilprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Sie forderte Schadensersatz vom Architekten wegen Mängeln im Schallschutz.
- Beklagte: Der Architekt des Gebäudes. Er bestritt die Mängel und die Schadensersatzforderungen.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) forderte Schadensersatz vom Architekten. Diese Forderungen hatte die WEG von der ehemaligen Bauträgerin wegen Schallschutzmängeln übernommen.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Kann eine Wohnungseigentümergemeinschaft von einem Architekten Schadensersatz für Baumängel verlangen, wenn die ursprüngliche Verkäuferin (die Bauträgerin) zum Zeitpunkt der Anspruchsübertragung selbst keinen ersatzfähigen Schaden mehr hatte, weil die Mängelforderungen der Wohnungskäufer bereits verjährt waren?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Die Berufung der Klägerin wurde zurückgewiesen.
- Zentrale Begründung: Die Bauträgerin hatte zum Zeitpunkt der Anspruchsübertragung keinen ersatzfähigen Schaden, da die Forderungen der Wohnungskäufer gegen sie wegen der Mängel bereits verjährt waren und ihr daher kein finanzieller Nachteil entstand.
- Konsequenzen für die Parteien: Die Klägerin erhält keinen Schadensersatz und muss die Kosten des Berufungsverfahrens tragen.
Der Fall vor Gericht
Warum klagte eine Wohnungseigentümergemeinschaft wegen Schallschutzmängeln gegen den Architekten?
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) zog vor Gericht und forderte von einem Architekten Schadensersatz in Höhe von fast einer halben Million Euro. Der Grund: erhebliche Schallschutzmängel in fünf Wohnungen eines Neubaukomplexes. Die Eigentümer machten geltend, dass der mangelhafte Schallschutz den Wert ihrer Immobilien mindere. Der Fall landete zunächst vor dem Landgericht Braunschweig, das die Klage jedoch abwies. Die WEG ließ nicht locker und legte Berufung beim Oberlandesgericht Braunschweig ein, um die Entscheidung anzufechten. Sie verlangte, dass der Architekt für den Schaden aufkommen und die geforderte Summe an die betroffenen Wohnungseigentümer auszahlen solle.

Die Argumentation der WEG stützte sich auf ein Verkehrswertgutachten. Dieses sollte belegen, dass die Wohnungen aufgrund der Schallprobleme, die als weitgehend unbehebbar galten, einen geringeren Marktwert hatten. Die Eigentümergemeinschaft argumentierte, dass zur Berechnung dieses Minderwerts auch die fiktiven Kosten einer Mängelbeseitigung herangezogen werden könnten. Darunter versteht man die Summe, die eine Reparatur theoretisch kosten würde, selbst wenn sie nicht durchgeführt wird. Die WEG war der Ansicht, dass diese Kosten ein fairer Maßstab für den erlittenen Wertverlust seien und das Gericht den Schaden auf dieser Grundlage schätzen könne.
Wie versuchte die WEG, die Schadensersatzansprüche des Bauträgers geltend zu machen?
Die WEG klagte nicht aufgrund eigener direkter Ansprüche gegen den Architekten, sondern machte Ansprüche geltend, die ihr von der ursprünglichen Bauträgerin, einer GmbH, übertragen worden waren. Diesen juristischen Vorgang nennt man Abtretung (§ 398 BGB). Eine Abtretung funktioniert ähnlich wie der Verkauf einer Forderung: Der ursprüngliche Gläubiger (hier die Bauträgerin) gibt sein Recht, eine Schuld einzufordern, an einen neuen Gläubiger (hier die WEG) weiter. Die WEG stützte sich auf eine Vereinbarung vom 26. März 2019, mit der die Bauträgerin ihre potenziellen Schadensersatzansprüche gegen den Architekten an die Eigentümergemeinschaft abgetreten hatte.
Der Architekt und einige andere Wohnungseigentümer, die dem Verfahren als sogenannte Nebenintervenienten beigetreten waren, zweifelten jedoch an der Wirksamkeit dieser Abtretung. Sie argumentierten, die Vereinbarung sei unklar formuliert. Insbesondere sei fraglich, ob die Ansprüche tatsächlich an die WEG als Gemeinschaft oder nicht vielmehr an einzelne, namentlich genannte Eigentümer abgetreten wurden. Zudem enthielt die Vereinbarung eine Klausel über einen wechselseitigen Verzicht, die nach Ansicht der Beklagtenseite die Abtretung inhaltlich leerlaufen ließ. Das Gericht musste also zunächst klären, ob die WEG überhaupt die richtige Partei war, um die Klage zu führen – eine Frage der sogenannten Aktivlegitimation.
Weshalb argumentierte der Architekt, dass kein ersatzfähiger Schaden entstanden sei?
Der beklagte Architekt verteidigte sich mit einem zentralen Argument: Der Bauträgerin, von der die WEG die Ansprüche erhalten hatte, sei selbst nie ein finanzieller Schaden entstanden. Ein Schadensersatzanspruch kann aber nur bestehen, wenn auch tatsächlich ein Schaden vorliegt. Der Architekt führte aus, dass die Wohnungskäufer die Kaufpreise bereits in den Jahren 2002 und 2003 vollständig bezahlt hatten, ohne wegen der Schallschutzmängel Geld einzubehalten. Der Bauträgerin fehlte es somit an einem konkreten Vermögensnachteil, denn sie hatte keine geringeren Einnahmen.
Noch entscheidender war jedoch die Einrede der Verjährung. Dieses juristische Instrument sorgt dafür, dass ein Anspruch nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann. Der Architekt argumentierte, dass die Ansprüche der Wohnungskäufer gegen die Bauträgerin längst verjährt waren. Hätten die Käufer die Bauträgerin also verklagen wollen, hätte diese die Zahlung mit dem Hinweis auf die abgelaufene Frist verweigern können. Wenn die Bauträgerin aber rechtlich nicht mehr zur Mängelbeseitigung oder zu Schadensersatzzahlungen an die Käufer verpflichtet war, hatte sie selbst auch keinen Schaden, den sie wiederum vom Architekten hätte ersetzt verlangen können. Ein Anspruch, der nicht mehr durchsetzbar ist, stellt keine finanzielle Belastung mehr dar.
Warum wies das Oberlandesgericht die Klage trotz der Schallschutzmängel ab?
Das Oberlandesgericht Braunschweig wies die Berufung der WEG zurück und bestätigte damit die Entscheidung der Vorinstanz. Die Klage scheiterte nicht an den formalen Hürden der Abtretung, sondern aus einem fundamentalen materiellen Grund: Zum Zeitpunkt der Abtretung der Ansprüche im Jahr 2019 hatte die Bauträgerin selbst keinen ersatzfähigen Schaden mehr, den sie an die WEG hätte abtreten können.
Die Richter stellten klar, dass bei einer Abtretung der neue Gläubiger (die WEG) nur die Rechte erhält, die der alte Gläubiger (die Bauträgerin) auch tatsächlich besaß. Der entscheidende Punkt war daher die finanzielle Situation der Bauträgerin. Das Gericht folgte hier der Logik eines Vorteilsausgleichs: Es wäre unbillig, der Bauträgerin einen Schadensersatzanspruch gegen den Architekten zuzusprechen, wenn sie selbst durch den Mangel keinen finanziellen Nachteil erlitten hat. Sie hatte die vollen Kaufpreise erhalten und war keinen Forderungen der Käufer mehr ausgesetzt. Ein Schadensersatz hätte sie also bessergestellt, als wenn der Bau von Anfang an mangelfrei gewesen wäre – sie wäre ungerechtfertigt bereichert worden.
Den entscheidenden Schlag versetzte die detaillierte Prüfung der Verjährung durch das Gericht. Die Richter rechneten genau nach:
- Die Ansprüche der Käufer gegen die Bauträgerin waren spätestens 2008 fällig.
- Ein gerichtliches Beweisverfahren hatte die Verjährung zwar zwischenzeitlich gestoppt (juristisch: gehemmt), doch diese Hemmung endete im August 2012.
- Danach lief die reguläre dreijährige Verjährungsfrist an.
- Spätestens Ende 2015 waren die Ansprüche der Käufer gegen die Bauträgerin damit verjährt.
Ein Schreiben des Anwalts der Bauträgerin aus dem Jahr 2017 bestätigte sogar, dass die Bauträgerin selbst von der Verjährung ausging. Da die Bauträgerin im Jahr 2019 rechtlich nicht mehr belangt werden konnte, hatte sie durch die Schallschutzmängel keine finanzielle Last mehr zu tragen. Folglich existierte kein Vermögensschaden, der einen Schadensersatzanspruch gegen den Architekten begründet hätte. Ohne einen solchen Schaden lief die Abtretung an die WEG ins Leere. Der Kette fehlte das entscheidende erste Glied.
Weshalb half der Klägerin das Argument der fiktiven Mängelbeseitigungskosten nicht?
Die WEG hatte versucht, den Schaden anhand der fiktiven Kosten für eine Sanierung zu berechnen. Doch dieses Argument konnte das Gericht nicht überzeugen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erlaubt die Abrechnung auf Basis fiktiver Kosten nur unter sehr engen Voraussetzungen und gerade nicht, wenn dies zu einer Überkompensation führt. Da das Gericht bereits feststellte, dass der Bauträgerin überhaupt kein Schaden entstanden war, kam es auf die Methode der Schadensberechnung gar nicht mehr an. Die Frage, wie hoch ein Schaden ist, stellt sich erst, wenn feststeht, dass überhaupt ein Schaden vorliegt. Genau das war hier nicht der Fall. Die gesamte Argumentationskette der WEG zur Schadenshöhe war somit für die Entscheidung nicht mehr relevant.
Warum ließ das Gericht die Revision zum Bundesgerichtshof zu?
Obwohl das Oberlandesgericht Braunschweig die Klage klar abwies, ließ es die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) zu. Eine Revision wird nur zugelassen, wenn ein Fall eine grundsätzliche Bedeutung hat oder zur Fortbildung des Rechts notwendig ist. Die Richter sahen hier eine solche grundsätzliche Frage: Wie wirkt es sich genau aus, wenn der ursprüngliche Anspruch auf mangelfreie Herstellung (der Erfüllungsanspruch) verjährt, bevor der Käufer die Abnahme erklärt und seine Gewährleistungsrechte geltend macht? Diese spezifische Rechtsfrage zur Verjährung im Baurecht ist vom BGH noch nicht abschließend geklärt worden. Um hier für Rechtssicherheit zu sorgen, öffnete das Gericht den Weg zur höchsten deutschen Zivilinstanz. Die WEG erhielt damit die Möglichkeit, das Urteil doch noch einmal überprüfen zu lassen. Die Kosten für das gescheiterte Berufungsverfahren muss sie jedoch tragen.
Die Urteilslogik
Ein Schadensersatzanspruch setzt stets einen tatsächlichen Vermögensnachteil voraus und kann nicht mehr durchgesetzt werden, wenn er verjährt ist.
- Existenz des Schadens als Grundlage: Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht nur, wenn der Geschädigte tatsächlich einen Vermögensnachteil erlitten hat; das Recht will niemanden durch Schadensersatz besserstellen, als er ohne den Mangel gestanden hätte.
- Verjährung als Anspruchsbarriere: Verjährt ein Anspruch, verliert er seine gerichtliche Durchsetzbarkeit; eine Abtretung überträgt dann keinen werthaltigen Anspruch mehr, da der ursprüngliche Gläubiger selbst nichts mehr fordern könnte.
- Priorität der Schadensexistenz vor der Bezifferung: Die Frage, wie ein Schaden zu berechnen ist, stellt sich erst, nachdem feststeht, dass dem Grunde nach überhaupt ein ersatzfähiger Schaden vorliegt.
Wer einen Anspruch gerichtlich verfolgt, muss dessen Existenz und Durchsetzbarkeit zum Zeitpunkt der Klageerhebung sorgfältig prüfen.
Benötigen Sie Hilfe?
Sehen Sie sich mit Architektenhaftung und Verjährungsfragen bei Schallschutzmängeln konfrontiert? Kontaktieren Sie uns für eine rechtliche Ersteinschätzung Ihres Anliegens.
Das Urteil in der Praxis
Für jeden, der im Baugeschäft Ansprüche abtritt oder erwirbt, sollte dieses Urteil ab sofort zur Pflichtlektüre gehören. Es demonstriert schonungslos: Eine vermeintlich starke Forderung läuft ins Leere, wenn der abtretende Gläubiger – hier die Bauträgerin – selbst keinen ersatzfähigen Schaden mehr hatte, weil seine eigene Haftung längst verjährt war. Selbst unbestreitbare Mängel und astronomische Sanierungskosten retten einen Anspruch nicht, wenn die Kette der Verantwortlichkeit an einem verjährten Glied reißt. Das ist eine teure Erinnerung daran, wie gnadenlos das Verjährungsrecht ist und warum akribische Due Diligence bei Abtretungen entscheidend ist, bevor man vor Gericht zieht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet die Verjährung für meine Mängelansprüche am Bau?
Verjährung bedeutet für Ihre Mängelansprüche am Bau das endgültige Aus der gerichtlichen Durchsetzbarkeit: Ist die gesetzliche Frist abgelaufen, können Sie selbst bei einem offensichtlichen Baumangel den Verursacher nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Dann bleiben Sie auf den Behebungskosten sitzen, weil die Geltendmachung des Anspruchs rechtlich erlischt.
Warum gibt es diese Fristen? Ansprüche verjähren, um Rechtssicherheit zu schaffen und alte Fälle abzuschließen. Juristen nennen das „Einrede der Verjährung“. Für Bauwerke beträgt die übliche Verjährungsfrist fünf Jahre nach Abnahme. Eine Wohnungseigentümergemeinschaft musste diese harte Realität erfahren: Obwohl massive Schallschutzmängel in ihrem Neubau vorlagen, scheiterte die Klage gegen den verantwortlichen Architekten. Klingt harmlos? Nicht vor Gericht.
Der Grund? Die ursprünglichen Ansprüche der Wohnungskäufer gegen den Bauträger waren längst verjährt – spätestens Ende 2015. Als die WEG im Jahr 2019 versuchte, diese Ansprüche per Abtretung geltend zu machen, war es aussichtslos. Der Bauträgerin war kein Vermögensschaden mehr entstanden, da sie ja selbst nicht mehr belangt werden konnte. Die Kette war unterbrochen.
Wer Baufehler entdeckt, muss sofort handeln und jede Frist kennen. Sichern Sie Ihre Mängelansprüche durch umgehende Dokumentation und holen Sie rechtzeitig juristischen Rat ein.
Kann ich abgetretene Bau-Mängelansprüche noch durchsetzen?
Abgetretene Bau-Mängelansprüche durchzusetzen, ist nur möglich, wenn der ursprüngliche Gläubiger – der Zedent – im Moment der Abtretung noch einen gültigen, nicht verjährten Anspruch besaß. Abtretung überträgt lediglich die vorhandenen Rechte. Ist der ursprüngliche Anspruch bereits erloschen, etwa wegen Verjährung, überträgt die Abtretung ins Leere. Ohne ein wirksames erstes Glied kann die Kette nicht halten.
Der Grund? Juristen nennen das das „Akzessorietätsprinzip“. Der neue Anspruchsinhaber, der Zessionar, bekommt nur das, was der alte Gläubiger tatsächlich hatte. Gerichte wie das Oberlandesgericht Braunschweig haben das klargestellt. Wenn etwa die Ansprüche des Bauträgers gegen den Architekten bereits verjährt waren, kann der Bauträger diese „toten“ Ansprüche nicht an eine Wohnungseigentümergemeinschaft abtreten. Der Architekt müsste dann keinen Schaden ersetzen.
Spätestens Ende 2015 waren im vorliegenden Fall die Ansprüche der Käufer gegen die Bauträgerin verjährt. Ohne eine finanzielle Belastung für die Bauträgerin fehlte jeder ersatzfähige Schaden. Deshalb war die Abtretung der Bau-Mängelansprüche an die WEG wirkungslos. Wer Bau-Mängelansprüche abtreten will, muss deren Gültigkeit und den Verjährungsstatus akribisch prüfen, sonst bleibt die Klage ohne Fundament.
Gilt Verjährung auch für meinen Bau-Schadensersatzanspruch?
Ja, auch Ihr Bau-Schadensersatzanspruch kann verjähren – oft schneller, als Sie erwarten. Diese Fristen sind nicht immer identisch mit den typischen fünf Jahren für Mängel am Bauwerk selbst. Wer die Ablauffristen ignoriert, verliert seinen Anspruch unwiederbringlich. Klingt hart? Ist es auch.
Der Grund: Ein Schadensersatzanspruch ist eng mit dem Ursprungsschaden verknüpft. Juristen nennen das „kein Schaden, keine Forderung“. Selbst wenn Ihr Bauvertrag fünf Jahre Gewährleistung für Mängel vorsieht, kann die reine Schadensersatzforderung – etwa gegen einen Planer – ganz anderen Verjährungsfristen unterliegen, oft der dreijährigen Regelverjährung (§ 195 BGB). Läuft die Frist für den ursprünglichen Mangelanspruch ab, erlischt häufig auch der darauf aufbauende Schadensersatzanspruch.
Ein aktuelles Beispiel zeigt die Tücken: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) klagte vor dem OLG Braunschweig auf fast eine halbe Million Euro Schadensersatz vom Architekten. Sie machten Schallschutzmängel geltend, die von der Bauträgerin an sie abgetreten worden waren. Doch die Richter sahen schwarz. Die Forderungen der Käufer gegen die Bauträgerin waren bereits Ende 2015 verjährt. Ohne diese Hauptlast hatte die Bauträgerin selbst keinen Schaden mehr, den sie weitergeben konnte. Die Abtretung ging ins Leere.
Dokumentieren Sie Baumängel sofort und prüfen Sie die Verjährungsfristen akribisch. Jede Verzögerung kann Sie den gesamten Bau-Schadensersatzanspruch kosten.
Wie kann ich Bau-Mängelansprüche richtig abtreten lassen?
Die richtige Abtretung von Bau-Mängelansprüchen erfordert juristische Präzision. Entscheidend für die Wirksamkeit ist, dass der ursprüngliche Gläubiger überhaupt noch einen durchsetzbaren Anspruch besitzt. Andernfalls läuft die Übertragung ins Leere und Sie stehen mit leeren Händen da. Eine unwirksame Abtretung kostet Nerven und viel Geld.
Die Regel lautet: Der neue Eigentümer eines Anspruchs, juristisch Zessionar genannt, tritt immer in die Fußstapfen des alten Gläubigers. Ist der ursprüngliche Anspruch bereits verjährt oder existiert beim ursprünglichen Gläubiger gar kein ersatzfähiger Schaden mehr, wird die Abtretung zur leeren Hülle. Ein Trugschluss, der teuer werden kann.
Gerade Bau-Mängelansprüche unterliegen oft kurzen Fristen. Das Oberlandesgericht Braunschweig bestätigte dies in einem Fall, wo eine Wohnungseigentümergemeinschaft Ansprüche gegen einen Architekten übertragen bekam. Fatal: Der ursprünglichen Bauträgerin war zum Zeitpunkt der Abtretung 2019 selbst kein Schaden mehr entstanden. Der Grund: Die ursprünglichen Käuferansprüche gegen die Bauträgerin waren bereits 2015 verjährt. Was nicht mehr durchsetzbar war, konnte auch nicht wirksam abgetreten werden. Die Abtretung der Bau-Mängelansprüche lief ins Leere.
Prüfen Sie vor jeder Abtretung die Substanz des Anspruchs – sonst droht ein finanzielles Fiasko!
Reichen fiktive Mängelbeseitigungskosten für meinen Bau-Schaden aus?
Nein, fiktive Mängelbeseitigungskosten sind im Baurecht als alleinige Basis für Schadensersatzansprüche kaum noch tragfähig. Der Bundesgerichtshof (BGH) macht klare Vorgaben: Ein Schadensersatzanspruch setzt einen tatsächlich erlittenen Vermögensschaden voraus. Das Gericht lehnt eine Abrechnung auf Basis theoretischer Reparaturkosten ab, wenn dies zu einer ungerechtfertigten Überkompensation des Geschädigten führen würde. Es geht um den realen Nachteil, nicht um eine hypothetische Sanierung.
Der Grund: Niemand soll durch einen Bau-Schaden bessergestellt werden, als er ohne den Mangel gewesen wäre. Jahrelang war es gängige Praxis, fiktive Kosten als Maßstab heranzuziehen. Doch die Rechtsprechung hat sich gewandelt. Gerichte prüfen heute akribisch, ob der Kläger wirklich einen monetären Nachteil erlitten hat.
Im Fall der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) vor dem Oberlandesgericht Braunschweig scheiterte die Klage genau daran. Obwohl die WEG mit einem Verkehrswertgutachten argumentierte, welches die Wohnungen als wegen Schallschutzmängeln wertgemindert auswies, und die fiktiven Beseitigungskosten zur Schadensberechnung nutzen wollte, griff das nicht. Die Bauträgerin, deren Ansprüche an die WEG abgetreten wurden, hatte selbst keinen ersatzfähigen Schaden mehr, da die Käufer die vollen Kaufpreise bezahlt und ihre Ansprüche bereits verjährt waren. Ohne einen tatsächlichen Schaden ist die Frage nach dessen Höhe, ob fiktiv oder real, schlicht irrelevant.
Wer einen Bau-Schaden geltend machen will, muss daher einen echten, belegbaren Vermögensverlust nachweisen. Dokumentieren Sie also jeden tatsächlichen finanziellen Nachteil, denn nur dieser zählt vor Gericht.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Abtretung
Eine Abtretung ist ein juristischer Vorgang, bei dem jemand sein Recht, eine Forderung einzufordern, an eine andere Person oder Organisation überträgt. Dieses Rechtsgeschäft ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 398 BGB) geregelt und dient dazu, Forderungen handelbar zu machen sowie Rechtspositionen flexibel verschieben zu können. Ein ursprünglicher Gläubiger kann so seinen Anspruch an einen Dritten weitergeben, ohne selbst tätig werden zu müssen.
Beispiel: Die Bauträgerin übertrug ihre möglichen Schadensersatzansprüche gegen den Architekten per Abtretung an die Wohnungseigentümergemeinschaft, damit diese die Klage führen konnte.
Aktivlegitimation
Ob jemand die sogenannte Aktivlegitimation besitzt, klärt die grundlegende Frage, ob eine Partei überhaupt berechtigt ist, eine Klage vor Gericht zu erheben und die geltend gemachten Ansprüche einzuklagen. Das Gericht muss dies prüfen, um sicherzustellen, dass nur der wahre Rechtsinhaber seine Rechte gerichtlich durchsetzt und unnötige Verfahren vermieden werden. Fehlt die Aktivlegitimation, wird eine Klage abgewiesen, selbst wenn der Anspruch inhaltlich bestünde.
Beispiel: Das Oberlandesgericht Braunschweig musste im vorliegenden Fall zunächst feststellen, ob die Wohnungseigentümergemeinschaft die erforderliche Aktivlegitimation besaß, um die Ansprüche der Bauträgerin gegen den Architekten gerichtlich zu verfolgen.
Fiktive Mängelbeseitigungskosten
Als fiktive Mängelbeseitigungskosten bezeichnet man die geschätzten, aber nicht tatsächlich aufgewendeten Beträge, die für die Beseitigung eines Mangels theoretisch anfallen würden. Diese Rechengröße wird herangezogen, um den Wertverlust einer Sache zu beziffern, ohne dass der Mangel tatsächlich behoben wird. Die Rechtsprechung erlaubt die Abrechnung auf Basis solcher fiktiven Kosten nur unter sehr engen Voraussetzungen, um eine ungerechtfertigte Überkompensation des Geschädigten zu verhindern.
Beispiel: Die Wohnungseigentümergemeinschaft versuchte, den durch die Schallschutzmängel erlittenen Wertverlust ihrer Immobilien anhand der fiktiven Mängelbeseitigungskosten für eine Sanierung zu beziffern.
Hemmung (der Verjährung)
Die Hemmung der Verjährung bedeutet, dass der Lauf einer Verjährungsfrist für eine bestimmte Zeit angehalten wird und nach Wegfall des Hemmungsgrundes wieder fortgesetzt wird, ohne dass die bereits abgelaufene Zeit verloren geht. Dieses Instrument ist dazu da, Gläubigern in besonderen Situationen, wie etwa während eines laufenden gerichtlichen Beweisverfahrens oder bei Verhandlungen, eine faire Chance zur Durchsetzung ihrer Ansprüche zu geben. So soll verhindert werden, dass Ansprüche während relevanter juristischer Auseinandersetzungen verjähren.
Beispiel: Ein gerichtlich angeordnetes Beweisverfahren bewirkte eine Hemmung der Verjährung für die Ansprüche der Käufer gegen die Bauträgerin, die allerdings im August 2012 endete und die Frist danach weiterlaufen ließ.
Verjährung
Verjährung ist der rechtliche Umstand, dass ein Anspruch nach Ablauf einer gesetzlich festgelegten Frist nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann, selbst wenn er ursprünglich bestanden hat. Mit diesem Prinzip schafft der Gesetzgeber Rechtsfrieden und Rechtssicherheit, indem er alte Streitigkeiten abschließt und Schuldner vor ewig währenden Forderungen schützt. Nach Eintritt der Verjährung kann sich der Schuldner auf die sogenannte „Einrede der Verjährung“ berufen und die Erfüllung des Anspruchs verweigern.
Beispiel: Die ursprünglichen Ansprüche der Wohnungskäufer gegen die Bauträgerin waren spätestens Ende 2015 verjährt, wodurch die Klage der Wohnungseigentümergemeinschaft gegen den Architekten mangels eines durchsetzbaren Schadens ins Leere lief.
Vorteilsausgleich
Der Vorteilsausgleich ist ein fundamentales Prinzip im Schadensersatzrecht, das verlangt, dass Vorteile, die einer geschädigten Person durch dasselbe schädigende Ereignis entstehen, mit dem zu ersetzenden Schaden verrechnet werden müssen. Dieses Prinzip soll sicherstellen, dass niemand durch einen Schaden bessergestellt wird, als er ohne das schädigende Ereignis gewesen wäre. Es verhindert eine ungerechtfertigte Bereicherung und gewährleistet eine faire Kompensation des tatsächlich erlittenen Nachteils.
Beispiel: Das Gericht wandte das Prinzip des Vorteilsausgleichs an, da die Bauträgerin die vollen Kaufpreise erhalten hatte und somit keinen Vermögensnachteil durch die Schallschutzmängel erlitt, der einen Anspruch gegen den Architekten hätte begründen können.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Verjährung (§ 195 BGB, § 199 BGB)
Verjährung bedeutet, dass ein Anspruch nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Ansprüche der Wohnungskäufer gegen die Bauträgerin waren bereits verjährt, als diese ihre eigenen potenziellen Ansprüche an die WEG abtrat, weshalb die Bauträgerin keinen ersatzfähigen Schaden mehr hatte, den sie hätte weitergeben können.
- Schadensersatzanspruch und Schaden (Allgemeines Rechtsprinzip)
Ein Schadensersatzanspruch besteht nur, wenn einem Betroffenen tatsächlich ein finanzieller Nachteil oder Verlust entstanden ist.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die Bauträgerin die vollen Kaufpreise für die Wohnungen erhalten und aufgrund der Verjährung keine Ansprüche der Käufer mehr befürchten musste, hatte sie selbst keinen finanziellen Schaden erlitten, der vom Architekten hätte ersetzt werden können.
- Abtretung (§ 398 BGB)
Die Abtretung ist der rechtliche Vorgang, bei dem ein Gläubiger sein Recht, eine Forderung einzufordern, an eine andere Person überträgt.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) konnte nur klagen, weil die ursprüngliche Bauträgerin ihre potenziellen Schadensersatzansprüche gegen den Architekten an die WEG abgetreten hatte.
- Vorteilsausgleichung (Allgemeines Rechtsprinzip)
Dieses Prinzip besagt, dass Vorteile, die jemandem durch ein schädigendes Ereignis entstehen, mit einem entstandenen Schaden verrechnet werden müssen, damit die geschädigte Person nicht ungerechtfertigt bessergestellt wird.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die Bauträgerin bereits die vollen Kaufpreise erhalten hatte und wegen der verjährten Ansprüche der Käufer keine finanziellen Einbußen mehr befürchten musste, hätte ein Schadensersatzanspruch sie ungerechtfertigt bessergestellt, als sie es bei einem mangelfreien Bau gewesen wäre.
- Aktivlegitimation (Allgemeines Rechtsprinzip)
Aktivlegitimation bedeutet, dass die klagende Partei rechtlich dazu berechtigt sein muss, den geltend gemachten Anspruch im eigenen Namen zu verfolgen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Im vorliegenden Fall war die Aktivlegitimation der WEG umstritten, da bezweifelt wurde, ob die Abtretung der Ansprüche von der Bauträgerin an die WEG wirksam erfolgt war und die WEG daher überhaupt klagen durfte.
Das vorliegende Urteil
OLG Braunschweig – Az.: 8 U 193/22 – Urteil vom 31.07.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.